Landwirtschaft und Ernährung

Das Hauptziel der Achse Landwirtschaft und Ernährung besteht darin, die Klimawirkung der Landwirtschaft und des Lebensmittelkonsums zu reduzieren und gleichzeitig diesen sehr wichtigen Wirtschaftssektor zu fördern. Die spezifischen Ziele der Achse Landwirtschaft und Ernährung sind:
- Reduzieren der Treibhausgasemissionen der Produktionskette der Lebensmittel und ihres Transports;
- Verringern der Treibhausgasemissionen des Agrarsektors;
- Erhöhen der Kohlenstoffspeicherkapazität der Böden.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | Sensibilisierung für gute Praktiken zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden | 100% | 40% | Bevölkerung | 300 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Sensibilisierung und Förderung von Massnahmen, die in landwirtschaftlichen Praktiken zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung umzusetzen sind (z. B. durch Förderung von Produktionssystemen mit möglichst geringer Bodenbearbeitung oder regenerativen Produktionsmethoden, welche die Bildung von Humus und Grasland begünstigen). Darüber hinaus wird die Einführung von Massnahmen zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung und die Überwachung ihrer Auswirkungen unterstützt (Befund der Kohlenspeicherung bis zu einer Tiefe von 1 m auf den betroffenen Böden vor und nach der Anwendung der Massnahmen). | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme S.5.12) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | ||||
| A.2.1 | Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft | 85% | 50% | Bevölkerung | 350 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten im Kanton bei der Durchführung einer Analyse der Kohlenstoffbilanz ihres Betriebs. Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten im Kanton bei der Umsetzung von Massnahmen zur Verringerung der Emissionen ihres Betriebs. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.2.1 besteht darin, die Landwirtinnen und Landwirte über Programme und Massnahmen zu informieren, die zur Reduzierung der Emissionen ihrer Betriebe beitragen können. | - | Die Umsetzung der Massnahme A.2.1 hat Folgendes ermöglicht: • die Berechnung des ökologischen Fussabdrucks von 15 landwirtschaftlichen Betrieben des Kantons mit Hilfe des Tools CAP2ER; • die Bewertung des Tools CAP2ER zur Berechnung des CO₂-Fussabdrucks sowie das Potenzial für Verbesserungen und Anpassungen dieses Tools an die Besonderheiten der Betriebe im Kanton; • die Bewertung von Vorschlägen für mögliche Ansätze zur THG-Reduktion auf energetischer Ebene (AgroCleanTech-Bericht zur Energieanalyse in der freiburgischen Landwirtschaft). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.3) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich THG-Reduktion»). | - | •Bericht AgroCleanTech «Analyse énergétique dans l’agriculture fribourgeoise» (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/2023-06-30_Analyse_AgroCleanTech.pdf | ||||
| A.2.2 | Abwärmenutzung für Heubelüftungsanlagen | 30% | 65% | Bevölkerung | 220 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2024 | Melinda Zufferey-Merminod | Finanzielle Unterstützung für Landwirte/-innen, die Abwärme unter dem Dach oder unter Photovoltaikanlagen für die Heubelüftungsanlagen nutzen. | Die Massnahme A.2.2 hat das übergeordnete Ziel, alle Heubelüftungsanlagen, die mit einem Warmluftanzug ausgestattet werden können, bis zum Abschluss der Umsetzung anzupassen. | Dank der Massnahme A.2.2 konnten in einem ersten Schritt die Betriebe ermittelt werden, die mit einem mit erneuerbarer Energie funktionierendem Warmluftanzug ausgestattet werden können. Während des Identifikationsprozesses konnte das Prinzip der Wärmerückgewinnung bekannt gemacht werden. Ausserdem wurde eine Medienmitteilung veröffentlicht, um verstärkt auf die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung hinzuweisen. Seit der Ausarbeitung einer kantonalen Verordnung kann auf Subventionsanfragen eingegangen werden. Hierdurch konnte insgesamt 14 Betrieben, die über den Grossteil des Kantons verteilt sind, eine finanzielle Unterstützung zur Einrichtung eines auf erneuerbaren Energien beruhenden Warmluftanzugs gewährt werden. 6 Anträge wurden abgelehnt. | 9 weitere Betriebe erhielten die Förderung und 4 Anträge wurden abgelehnt. Im gleichen Jahr wurden 7 Betriebe besucht, um den Bau der Anlage zu validieren; nur 1 Anlage wurde noch nicht realisiert. Es wird daher in Zukunft abgeklärt werden müssen, wie mit den Fällen von geförderten, aber nicht realisierten Anlagen umzugehen ist. Im Durchschnitt haben die Wärmetauscher der geförderten Anlagen eine äquivalente Leistung von 196 kW (die äquivalente Leistung errechnet sich aus der Leistung eines brennstoffbetriebenen Kessels zur Erzeugung der gleichen Wärme), mit einem Minimum von 54 kW und einem Maximum von 506 kW. Im Jahr 2022 ist ein leichter Rückgang der bewilligten Fördermittel im Vergleich zum Jahr 2021 zu verzeichnen. Es ist daher wichtig, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, um die Gründe für diesen Rückgang zu verstehen, sollte er sich bestätigen. Die ursprünglich bis Ende 2022 gültige Verordnung wurde vom Staatsrat im Dezember 2022 für die Gewährung von Subventionen bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. | Die Zahl der Betriebe, die eine Unterstützung beantragten, war erheblich geringer als in den beiden Vorjahren (3). Die geringe Nachfrage lässt sich nicht wirklich erklären, da die Massnahme vielen Landwirtinnen und Landwirten bekannt ist, die Informationen auch unter den Spezialisten für Gebäudeberatung verbreitet wurden und der Betrag relativ attraktiv zu sein scheint. Im Jahr 2024 werden andere Informations- und Kommunikationsmethoden zum Zug kommen. 2023 fanden 6 Kontrollbesuche statt, was mehr als der Hälfte der 2022 geförderten Anlagen entspricht (9). | Drei Betriebe beantragten eine Förderung für die Installation von Anlagen zur Abwärmenutzung, die ihnen auch gewährt wurde. Ein Antrag wurde wegen der Anordnung der Anlage abgelehnt. | Im Jahr 2025 sollen 8 landwirtschaftliche Betriebe bei der Installation von Anlagen zur Abwärmenutzung unterstützt werden. | •Verordnung: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/915.11 • Medienmitteillungen: - https://www.fr.ch/de/grangeneuve/news/unterstuetzung-fuer-die-abwaermenutzung-fuer-heubelueftungsanlagen-eine-massnahme-die-sich-wachsender-beliebtheit-erfreut - https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/24-klimaplan-landwirtschaft/457-warmluftanzug-fuer-heubelueftungen-fortsetzung-der-unterstuetzung-beim-bau • Formular für die Beantragung von Beiträgen: https://grangeneuve-conseil.ch/phocadownload/Recuperateurs_soutien/D%20-%20Formulaire%20dinscription_2023.pdf | |||
| A.2.3 | Förderung von erneuerbaren Energien für die Gewächshausproduktion | 95% | 50% | Bevölkerung | 250 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Die Umstellung auf erneuerbare Energien für die Gewächshausproduktion unterstützen. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich THG-Reduktion»). | - | - | ||||
| A.2.4 | Förderung von kurzen Lieferketten und Unterstützung des lokalen Konsums | 105% | 70% | Staat FR, Bevölkerung | 260 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Förderung (Sensibilisierungskampagne, Subventionen, Integration des staatlichen Gaststättengewerbes) von kurzen Lieferketten und des lokalen Konsums (insbesondere Direktkauf auf Bauernhöfen, Einkaufsplattform für lokale Produkte, Förderung lokaler Akteure für die Produktverarbeitung). | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.2.4 liegt in der Förderung eines innovativen und offenen Ökosystems der Region Freiburg/Genfersee im Bereich des lokalen Konsums. Es stellt die Landwirtinnen und Landwirte wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nahrungsmittel produzieren, in den Mittelpunkt, unterstützt junge landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Betriebe und fördert die Entwicklung neuer Projekte am Schnittpunkt von Forschung und Vermarktung. Diese Vision setzt die Beteiligung der Behörden, der das Unternehmertum und die Innovation fördernden Ökosysteme sowie der landwirtschaftlichen Beratung, die im Dienst dieser Zielgruppen und in Verbindung mit diesen Themen steht, voraus, damit die unterschiedlichen Instanzen auf interkantonaler Ebene Synergien entwickeln können. | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: • Organisation eines Coaching von 3 Sitzungen für die Umsetzung eines der 3 Freiburger Projekte, die an der Star'Terre-Ausschreibung 2020/21 teilgenommen haben; • technisch-wirtschaftliche Analyse des ausgewählten Projekts «De la terre à l’assiette» des Vereins FARA; • Dreh eines Kurzvideos, die dieses Mikrobetrieb-Projekt vorstellt. | Im zweiten Jahr der Umsetzung waren 6 Projekte geplant; deren 4 wurden durchgeführt: • Unterstützung des Projekts der Lebensmittelbank; • Fortführung und Abschluss des Coaching für das Projekt «De la terre à l’assiette» des Vereins FARA; • Kommunikation im Rahmen des Coaching des Projekts «De la terre à l’assiette»; • Entwicklung eines Prototyps für die Plattform «Regional kochen». 2 Projekte konnten nicht realisiert werden: • Die geplante Unterstützung für das Projekt «Jardin co-évolutif» in Grangeneuve konnte aufgrund der Verzögerung des Projekts nicht vergeben werden. • Die Veranstaltung über Lebensmittelverschwendung fand aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht statt. Es konnte 1 zusätzliches Projekt finanziert werden: • Realisierung des Branding der Plattform «Regional Kochen». | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Unterstützung des direktionsübergreifenden Projekts der Freiburger Lebensmittelbank; • Bereitstellung eines Gebäudes für die Nahrungsmittelbank ab Juli 2023 für eine begrenzte Zeit auf dem Gelände der Poyakaserne, damit das Projekt so schnell wie möglich und unter den bestmöglichen Bedingungen anlaufen kann, ohne die zukünftige Entwicklung des Geländes in Frage zu stellen. • Unterstützung bei der Realisierung der Plattform De-Saison.ch, die die Kontaktaufnahme zwischen lokalen Produzenten und Lieferanten der Gemeinschaftsgastronomie erleichtern will (Business to Business). Diese Plattform wurde von der Firma Local Impact entwickelt und vom Staat Freiburg auf der Grundlage der Verordnung zur Unterstützung der Wiederankurbelung des lokalen Handels (Massnahme 21 des Plans zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft und des kantonalen Klimaplans) finanziert. | Die Plattform befindet sich seit Anfang 2024 in der Testphase. Sie ist intuitiv zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Zunächst wurden die Restaurants, die die Charta unterzeichnet haben (rund 30), sowie die durch Fribourg anerkannten Restaurants (rund 30) und die Restaurants mit dem Label Fourchette verte (rund 30) kontaktiert. Am 25. November 2024 fand die erste Sitzung des neuen Steuerungsausschusses (Comité De-saison) statt. Die ersten Rückmeldungen zur Nutzung im Jahr 2024 bestätigen, dass die Plattform einfach und intuitiv zu bedienen ist. Allerdings wird sie noch zu wenig genutzt und entspricht nicht den Bedürfnissen aller befragten Akteure. | Für 2025 soll die Kommunikation priorisiert werden. 2 Arten der Kontaktaufnahme: • 1. Qualitativ: regelmässige Gespräche und Stimmungsbarometer bei 5 Gastronomen und 5 Produzenten, die langfristig begleitet werden und Feedback geben; • 2. Quantitativ: Ausbau der Nutzerbasis und Stärkung der Nutzung durch die derzeit auf der Plattform vertretenen Produzenten und Gastronomen. | •Website der Freiburger Lebensmittelbank: https://www.banquealimentairefribourgeoise.ch/de/ •Antwort des Staatsrat auf das Postulat «Schaffen einer Lebensmittelbank!»: https://api.fr.ch/public/parlinfo/assets/v1/documents/de_RCE_2021-GC-165_Banque_alimentaire.pdf •Medienmitteilung «Regional Kochen»: https://www.fr.ch/de/ilfd/news/regional-kochen-eine-charta-fuer-eine-nachhaltige-ausgewogene-und-regionale-ernaehrung-in-der-freiburger-gemeinschaftsgastronomie •Website De Saison: https://de-saison.ch/ | |||
| A.3.1 | Massnahmen zur Förderung einer kohlenstoffarmen und ausgewogenen Ernährung | 100% | 65% | Bevölkerung | 150 000 CHF | Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung und Integration der Klimafragen in das Programm Fourchette verte - Ama terra für die Ernährung in familienergänzenden Einrichtungen. Einbeziehung der Herausforderungen einer CO₂-armen Ernährung in den Hauswirtschaftsunterricht. Kantinen sollen ermutigt werden, ein vegetarisches Menü anzubieten und regionale Produkte einzukaufen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.3.1 lässt sich in 2 Schwerpunkte unterteilen: • A.Förderung der Schaffung von Umgebungen, die einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung in den familienergänzenden Betreuungseinrichtungen des Kantons Freiburg förderlich sind. Dieses Ziel soll auf lange Sicht (2022–2026) durch mehr Zertifizierungen mit dem Label Fourchette verte – Ama terra der familienergänzenden Betreuungseinrichtungen im Kanton Freiburg erreicht werden. • B.Ermutigung, die Praktiken im Hauswirtschaftsunterricht (HWU) weiterzuentwickeln; Tipps zur Integration von Zero Waste, Grosseinkauf; Ermutigung zur Unterstützung der biologischen Landwirtschaft. Ausbildung von Lehrkräften, die dies wünschen. Erstellen von Materialien nach Bedarf. Unterstützung der Aufnahme von Flexitarier-Rezepten in den HWU. | - | Was den Schwerpunkt A betrifft, so hat sich im Jahr 2022 die Gesamtzahl der Betriebe mit dem Label Fourchette verte – Ama terra im Kanton Freiburg um 6 erhöht, von 55 auf 61. Die Bilanz des Jahres lautet wie folgt: 11 neu verliehene Labels, davon 6 Fourchette verte – Ama terra Junior, und 1 Ama terra Kleinkinder, sowie 3 zurückgezogene Labels (3 Aufgaben). Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: • 2 Sitzungen zur Vorstellung des Labels Fourchette verte für 39 Personen; • 6 Schulungen für Testerinnen und Tester (davon 4 individuell, insgesamt 15 geschulte Personen); • 1 Schulung für einen neuen Koch und 3 Kurse für Fourchette-Verte-Köche (35 Teilnehmer); • 1 Schulung zur Erstellung von Zwischenmahlzeiten für das Personal (15 Personen); • Moderation von 2 Sitzungen zur Vorstellung des Labels (39 Personen) sowie von 2 Ausstellungen über Snacks und 2 Ständen mit Wettbewerben, die mündlich mit den Eltern in 2 Kindertagesstätten durchgeführt wurden (insgesamt 105 Personen). Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das Label Fourchette Ama terra durch den Klimaplan ermöglichte es, die Ausstattung der Ernährungsberater zu erhöhen und eine Anhebung der maximalen Quote für Einrichtungen auf 70 in Betracht zu ziehen, mit einer Priorisierung für Labels mit dem Ama-terra-Profil. Die Umsetzung der Massnahme führte für den Schwerpunkt B zu folgenden Ergebnissen: • Einführung des Zero Waste Kits in den Schulen, für das es positive Rückmeldungen gab, wobei die Form noch an die Klassen angepasst werden muss; • Ausweitung der Kommunikation zu Beginn des Jahres mit einem Brief an die Eltern; • Präsentation des Videos zu Tipp Nr. 1; • Organisation einer Pause in der OS Domdidier mit lokalen Produkten (herbstliche Früchte). | Die Förderung des Labels Fourchette Verte (FV) Ama terra war im Jahr 2023 erfolgreich: Es wurden 3 FV-Betriebe auf FV Ama terra und 2 neue Krippen direkt auf Ama terra umgestellt wurden (insgesamt 5 Label FV Ama terra). Das Label wurde wiederholt vorgestellt und die Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch der Köche/innen ist spürbar. Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: • 5 Schulungen für Testpersonen (insgesamt 10 geschulte Personen); • 4 Kurse für Köche/innen (79 Teilnehmer/innen, davon 1 Schulung für die Köche/innen der Chefkochrunde in Zusammenarbeit mit der Charta Regional kochen mit 50 Teilnehmende); • 14 Informationsveranstaltungen (Vorstellung des Labels, Informationen über Zwischenmahlzeiten/Milchprodukte, für insgesamt 135 Teilnehmende, davon 1 Vorstellung des Labels und der Charta anlässlich eines Klima-Lunches mit 95 Teilnehmenden); • 1 Ausbildung für einen neuen Koch; • 1 Auftritt in Radio Freiburg. | Im Jahr 2024 erhielten zwei neue Einrichtungen das Label «Fourchette verte Ama Terra», darunter erstmals eine Einrichtung für Erwachsene im Kanton. Damit steigt die Zahl der mit «Ama Terra» ausgezeichneten Einrichtungen im Kanton Freiburg auf insgesamt 19. Die Öffentlichkeitsarbeit von «Ama Terra» trägt Früchte: Mittlerweile trägt fast ein Drittel der mit «Fourchette verte» ausgezeichneten Einrichtungen im Kanton das Label «Ama Terra». Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: •12 Schulungen für Testerinnen und Tester (insgesamt 20 Teilnehmende), in Gruppen oder einzeln; • 3 Kurse für Köchinnen und Köche (insgesamt 23 Teilnehmende); • 3 Schulungen für neue Köchinnen und Köche (insgesamt 7 Teilnehmende); • 10 Schulungen mit insgesamt 174 Teilnehmenden zu folgenden Themen: das Label FV und FV Ama Terra in der Praxis, Snacks, Ernährung von Kindern und Vorurteile; • 6 Sitzungen zur Überwachung der Speisepläne mit den Köchinnen und Köchen (insgesamt 7 Teilnehmende); • Informations- und Präsentationsveranstaltungen zum Label mit insgesamt 39 Teilnehmenden, darunter 25 Personen bei einer Teilnahme an einem von den Klima-Grosseltern organisierten Mahl; • 1 Auftritt im Westschweizer Fernsehen (RTS) für einen Bericht über vegetarische Gerichte in den Krippen von Fourchette verte (nach der Veröffentlichung der neuen Ernährungspyramide). (BETRIFFT NICHT DIE KKP-SUBVENTIONEN) Auf Schweizer Ebene wurde ein Werbevideo über das Label Ama Terra in französischer und deutscher Sprache gedreht. Dieses Video ist ein strategisches Kommunikationsinstrument, um das Label Fourchette verte Ama Terra bei den Akteuren der Branche bekannt zu machen. Es hebt das Engagement des Labels in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ernährungsqualität hervor und stärkt gleichzeitig seine Sichtbarkeit in den relevanten Fachkreisen. | 2025 wird Fourchette verte Fribourg folgende Dienstleistungen erbringen: • Werbung für das Label Ama Terra in den Freiburger Einrichtungen, insbesondere bei Einrichtungen, die bereits mit dem Label FV Junior oder FV Kleinkinder zertifiziert sind (für einen Übergang zu Ama Terra) und in den Einrichtungen, die sich noch zertifizieren lassen wollen; • Betreuung der zertifizierten Einrichtungen (unabhängig davon, ob sie die Charta des Projekts zur Gemeinschaftsgastronomie unterzeichnet haben oder nicht), Verwaltung der mit der Zertifizierung verbundenen Aufgaben (Planung und Schulung der Testerinnen und Tester, Analyse der Speisepläne, Testmahlzeiten, Überwachung der Speisepläne, Schulung der Küchenteams und der Kundschaft); • aktive Zusammenarbeit mit der Charta «Regional Kochen» für die Arbeit mit den unterzeichnenden UND zertifizierten Einrichtungen und für die strategische Arbeit (COPIL und interkantonale Zusammenarbeit mit den Kantonen, Fourchette verte und Regional Kochen). | •Website Fourchette verte Ama Terra: https://fourchetteverte.ch/ •Werbevideo Ama Terra: https://www.youtube.com/watch?v=4_or8Ft0ias et https://www.youtube.com/watch?v=qC-EBT_jn_E | |||
| A.5.1 | Unterstützung und Valorisierung von Biogasanlagen im Kanton Freiburg | 0% | 65% | Gemeinden, Bevölkerung | 160 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung und Valorisierung von Biogasanlagen, um die Nutzung von Hofdüngern und organischen Abfällen zu optimieren. | Diese Massnahme bezweckt den Erhalt und die Optimierung der bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen im Kanton Freiburg und die Förderung neuer Projekte. Damit das Hauptziel, der Ersatz fossiler Energien, erreicht werden kann, ist vorgesehen, die Menge Hofdünger, die in landwirtschaftlichen Biogasanlagen umgewandelt wird, langfristig zu steigern. Hierdurch können klimaschädigende Methanemissionen verringert und erneuerbare Energien erzeugt werden. | Folgende Studien wurden beendet: • Optimierung des Gebrauchs von Hofdünger bei bereits bestehenden Anlagen; • Entwicklung von Projekten für landwirtschaftliche Biogas-Tankstellen. Sie bestehen jeweils aus einem theoretischen und einem praktischen Teil und untersuchen konkrete Fragestellungen zu Freiburger Anlagen. Die Ergebnisse dieser Studien sind für die Praxis von Nutzen und ermöglichen die Steigerung der Klimaschutzleistung der landwirtschaftlichen Biogasanlagen des Kantons durch verschiedene Optimierungsoptionen. Folgende Studien wurden teilweise durchgeführt (ca. zu 50 %): • Potenzial für die Nutzung von Hofdünger im Kanton. • Durchführung einer Studie zum Transport von Biomethan. Des Weiteren konnten durch die Massnahme A.5.1 folgende Ergebnisse erzielt werden: • Aufstellung einer Liste mit verschiedenen Möglichkeiten zur Optimierung der in Betrieb befindlichen Biogasanlagen; • Wirtschaftlichkeitsberechnungen und notwendige Voraussetzung für die Umsetzung dieser Optimierungen; • Wegleitung für die Umsetzung von Biogas-Tankstellenprojekten. | Folgende Studien wurden beendet: • Nutzungspotenzial von Hofdünger im Kanton; • Studie zum Transport von Biomethan; • Untersuchung neuer Rentabilitätsmodelle für zukünftige Einrichtungen. Die Studie half einigen Einrichtungen dabei, Optimierungsmassnahmen einzuführen, um die Reduzierung der Methanemissionen aus der Lagerung von Hofdünger zu erhöhen. Neben der Unterstützung der Freiburger Landwirte war die Studie auch für andere Anlagen auf nationaler Ebene von Nutzen. Die Ergebnisse wurden an einem Weiterbildungstag vorgestellt. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind im Alltag für die Beratung der Landwirte nützlich. | 2023 gab es eine Pause bei der Umsetzung dieser Massnahme; denn neue Bundesverordnungen werden sich auf die Zukunft des Biogases im Kanton auswirken. Die Auswirkungen werden eingeschätzt werden müssen, bevor die Umsetzung fortgesetzt wird. | Die Massnahme wurde 2024 ausgesetzt, da neue Bundesverordnungen erwartet werden, die sich auf die Zukunft des Biogases im Kanton auswirken werden. | Im Jahr 2025 soll die Massnahme dazu genutzt werden, im Rahmen der Antwort des Staatsrats auf das Postulat 2024-GC-123 «Welche Strategie für die Entwicklung von Biogas in unserem Kanton?» eine Studie in Auftrag zu geben. | •Factsheet Biogas Treibstoff (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51factsheetbiogazcarburant.pdf •Studie zum Transport von Biomethan (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51etude-sur-le-portage-du-biogaz-a-fribourg.pdf •Bericht zur Studie über ein neues Rentabilitätsmodell (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51rapport-nouveau-modele-rentabiliteinstallations-de-biogaz.pdf •Bericht zur Untersuchung des Düngemittelpotenzials (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51etude-potentiel-engrais-ferme.pdf?check_logged_in=1 | |||
| A.5.2 | Begrenzung der Freisetzung von CO₂ aus humosen Böden | 100% | 50% | Bevölkerung | 120 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Begrenzung der Freisetzung von CO₂ durch Austrocknung und Bewirtschaftung von humosen Böden (Schwarzerden) in landwirtschaftlichen Gebieten. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.2.3, S.5.10, S.5.11 und A.1.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | ||||
| A.6.1 | Durchführung eines Pilotprojekts über Düngerausbringungsmethoden, welche die Auswirkungen auf das Klima verringern | 85% | 35% | Staat FR, Bevölkerung | 150 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Durchführung eines Pilotprojekts zur Erprobung der Methode der sensorgestützten Ausbringung von Dünger auf Getreidefeldern, die auch auf den Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz beruht. | Die Massnahme A.6.1 hat die Durchführung eines Pilotprojekts zur Erprobung der Methode der sensorgestützten Ausbringung von Dünger auf Getreidefeldern zum übergeordneten Ziel. Ziel des Projekts ist es, die N2O-Emissionen (Lachgas) zu reduzieren, die durch die Ausbringung von Düngern verursacht werden. Das Projekt stützt sich auch auf die Grundlagen für die Düngung im Acker- und Futterbau (GRUD) von Agroscope. | - | Erstellung mit Drohnen eines Videos über die vier On-Farm-Versuche, die in Grangeneuve und auf anderen Bauernhöfen im Kanton stattfanden. | Die Umsetzung dieser Massnahme wurde 2023 fortgesetzt, aber nicht durch den kantonalen Klimaplan finanziert. | Im Jahr 2024 ermöglichte die Massnahme die Unterstützung des Projekts SIMONE. | Im Jahr 2025 soll die Unterstützung des Projekts SIMONE fortgesetzt werden. | •https://www.youtube.com/watch?v=Ehj35jJ7oqg •https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/pflanzenschutz/herbologie/simone-projekt.html •https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/klimaplan-landwirtschaft/projekte#projekt-simone | |||
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich Kommunikation | 90% | 40% | Bevölkerung | 250 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich Kommunikation verwaltet die Kommunikation der Massnahmen des Klimaplans Landwirtschaft. | Der Bereich Kommunikation zielt darauf ab: die Strategie für die Dachkommunikation zu entwickeln; die Aktivitäten der anderen Bereiche in Bezug auf die Kommunikation (Website, soziale Medien, interne Kommunikation usw.) zu unterstützen und den gesamten Prozess in Verbindung mit dem Wettbewerb zu verwalten. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Im ersten Jahr der Umsetzung wurde der Wettbewerb für den Klimaplan Landwirtschaft mit einer Kommunikationskampagne gestartet: •Organisation einer Medienkonferenz zum Start des Wettbewerbs; •Schaffung eines Flyers •Kampagne in sozialen Netzwerken; Mailing an Landwirtinnen und Landwirte und Veröffentlichung in der Zeitschrift Terre à Terre; •Artikel und Anzeigen in den Medien, soziale Netzwerke; •parallel dazu Ausbau der Seite Klimaplan Landwirtschaft auf der Website grangeneuve-conseil.ch. | Auswahl der Preisträger durch eine unabhängige Jury, Organisation der Preisverleihung mit einer Kommunikationskampagne (Kampagne in sozialen Netzwerken und in den Medien, Dreharbeiten für Videos), ständige Aktualisierung der Webseite grangeneuve-conseil.ch. Ende 2024 wurde eine Ausschreibung veröffentlicht, um eine Kommunikationsagentur mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Kommunikationsmassnahmen zu beauftragen. Am Ende des Verfahrens fiel die Wahl auf die Agentur Volontiers Sàrl. | Die Kommunikationskampagne 2025 richtet sich an die breite Öffentlichkeit und konzentriert sich auf die Bemühungen der Landwirtinnen und Landwirte zum Schutz des Klimas. Ziel dieser Kampagne ist es, die konkreten Massnahmen, die auf den landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt werden, aufzuwerten und sie ehrlich, ohne Übertreibung und mit Bescheidenheit zu präsentieren. MEIN KLIMAPLAN – Mehr als eine Aktion, ein Engagement. Dieser Slogan rückt die Landwirtinnen und Landwirte und ihre konkreten Massnahmen zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen in den Vordergrund. In jedem Kurzvideo kommen sie zu Wort, um ihr Engagement, ihr Know-how und ihre Erfahrungen im Alltag zu präsentieren. Jede Massnahme wird strategisch über mehrere Medien umgesetzt: • 1. Videoreportage • 2. Redaktioneller Artikel • 3. Spezifische Posts in den sozialen Netzwerken • 4. Weitere Träger nach Massnahme • 5 Ausgewählte Projekte/ Massnahmen: Methan und Herdenmanagement; Staffelkulturen; CULTAN; Wärmerückgewinnung unter dem Dach; Beitrag für den Anbau von Körnerleguminosen | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/plan-climat-agriculture/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre | |||
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft | 85% | 35% | Bevölkerung | 1 130 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft entwickelt konkrete Massnahmen für eine klimaresiliente Landwirtschaft, insbesondere im Bereich des Bodens. | Ziel des Bereichs ist es, konkrete Massnahmen für eine Anpassung der Betriebe an die veränderten Produktionsbedingungen zu entwickeln. Dazu gehören die Einführung resilienterer Produktionssysteme, eine Anpassung des Boden- und Wassermanagements oder eine Anpassung der Fruchtfolge, Massnahmen im Rahmen der Agroforstwirtschaft oder die Reduzierung von Hitzestress. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: •Vertiefung des Themas Boden und klimaresiliente Landwirtschaft, inkl. Kohlenstoffsequestrierung in landwirtschaftlichen Böden, Verringerung der Erosion und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit; •Organisation eines Workshops mit den Sektorverantwortlichen von Grangeneuve, um die Beratung zu Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu stärken; •Entwicklung einer Massnahme, die ab 2024 die Gewährung eines Beitrags für den Anbau von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ermöglicht. | Start der Massnahme zur Zahlung eines Flächenbeitrags von 400 CHF/ha für Körnerleguminosen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind, und Einführung von Aktivitäten zur Förderung ihres Absatzes. Insgesamt haben sich 28 Landwirtinnen und Landwirte mit einer Gesamtfläche von 70 ha angemeldet. Start der beiden Projekte Staffelkulturen (Ressourcenprojekt) und SIMONE. Nach der Einführung von AgroImpact: Koordination der Umsetzung des ClimaCert-Verfahrens, Recherche und Begleitung der landwirtschaftlichen Betriebe durch AGRI Freiburg. Über den Auftrag an AGRI Freiburg hinaus unterliegen auch die staatlichen Betriebe in Grangeneuve und Sorens dem ClimaCert-Verfahren. Vorbereitungsarbeiten für zwei neue Massnahmen: Wasserversorgung auf der Alp (Realisierung kleiner Bodenverbesserungsprojekte im Zusammenhang mit der Wasserversorgung der Alpen) und Unterstützung beim Erwerb von «Raindancer» (Steuerung der Bewässerung mit Kanonen mittels Geolokalisierung). | Hülsenfrüchte: Die für 2025 angemeldeten Hektarflächen sind um 30 % geringer als die für 2024 angemeldeten Flächen, dem Jahr, in dem die Massnahme eingeführt wurde. Da IPS/Protaneo keinen Vertrag über die Erzeugung von Erbsen für 2025 unterzeichnet hat (ausreichende Lagerbestände), wird die Absatzlage weiterhin angespannt bleiben. Die Verträge für Ackerbohnen bleiben bestehen. AgroImpact/ClimaCert: Das Mandat von AGRI Freiburg wird verlängert. Die Pilotphase dauert noch bis Ende des ersten Halbjahres 2025. Der staatliche Betrieb St. Aubin wird dem ClimaCert-Verfahren unterzogen. Einführung von zwei neuen Massnahmen: Wasserversorgung auf der Alp und Unterstützung beim Erwerb von «Raindancer». Fortsetzung der Projekte Staffelkulturen und SIMONE. | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/plan-climat-agriculture/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre | |||
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich THG-Reduktion | 90% | 50% | Bevölkerung | 600 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich THG-Reduktion entwickelt konkrete Massnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. | In diesem Rahmen sollen Massnahmen entwickelt werden, die der Freiburger Landwirtschaft helfen, ihre Treibhausgasbilanz zu verbessern, indem sie ihre Produktionssysteme optimiert, fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt oder die Verschwendung von Nahrungsmitteln vermeidet. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Grangeneuve hat die folgenden Massnahmen und Projekte initiiert: • Projekt PROSCOR: untersucht die Futtermitteleffizienz von Fleisch- und Milchvieh; denn im Kontext des Klimawandels stehen Proteine tierischer Herkunft im Wettbewerb mit Proteinen pflanzlicher Herkunft, die als effizienter bei der Nutzung von Ressourcen gelten; • Methan und Herdenmanagement mit Anbringung von Methan-Sensoren (Sniffers) zur Messung der Methanemission; • Entwicklung einer App in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbank und AGRI Freiburg zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung; • Start der Arbeit zum Thema Energie auf den Alpen. | Offizieller Start der Projekte Methan und Herdenmanagement und PROSCOR und Anwerbung von Betrieben. Programmierung der Foodwaste-App. Abschluss der Arbeit zum Thema Energie auf den Alpen. Vorbereitende Arbeiten für die neue Massnahme «Stallklima» (Verbesserung des Stallklimas – Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit – und damit Verminderung des Hitzestresses für die Tiere). | Fertigstellung der Foodwaste-App. Vor der Einführung wird noch eine Testphase mit Gemüsegärterinnen und ‑gärtnern durchgeführt und die Ausgestaltung der App weiter angepasst. Die Landwirtinnen und Landwirte haben über ihr Smartphone Zugriff und können ihre Angebote veröffentlichen. Die Freiburger Lebensmittelbank und AGRI Freiburg haben über eine Online-Plattform Zugriff, um die Angebote zu validieren (AGRI Freiburg) und den Bedarf bzw. die Anfragen zu veröffentlichen (Freiburger Lebensmittelbank). Einführung der neuen Massnahme «Stallklima». Fortsetzung der Projekte Methan und Herdenmanagement sowie PROSCOR. | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/plan-climat-agriculture/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre • https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/proscor/ |
Biodiversität

Das Hauptziel der Achse Biodiversität liegt in der Begleitung der Veränderung der Biodiversität und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme gegenüber dem Klimawandel. Die spezifischen Ziele der Achse Biodiversität sind:
- Vertiefen der Kenntnisse über die Auswirkungen des Klimawandels auf die Freiburger Biodiversität;
- Verstärken der ökologischen Infrastruktur;
- Informieren der Bevölkerung und der politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger über den Wert der Biodiversität und der Ökosystemdienstleistungen;
- Begleiten der Anpassung der Ökosysteme an die klimatischen Herausforderungen.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.1.1 | Durchführung von Sensibilisierungsaktionen für Ökosystemdienstleistungen | 85% | 40% | Gemeinden, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2023-2026 | Marie Pichard | Aktionen und Instrumente für gute Praktiken werden unterschiedlichen Zielpubilka bereitgestellt (Kantonsverwaltung, Gemeinde, Öffentlichkeit), um sie hinsichtlich des Werts der verschiedenen Ökosystemdienstleistungen und ihrer Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel zu sensibilisieren. | Beitrag an die Erneuerung der ökologischen Infrastruktur des Waldgebiets im Bois de Moncor. | - | - | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: • ein partizipativer Prozess, der von einer interdisziplinären Arbeitsgruppe durchgeführt wurde, die sich insbesondere aus 6 Grundschul- und Kindergartenklassen sowie 2 Gruppen von Erwachsenen mit unterschiedlichem Hintergrund im Zusammenhang mit dem Wald zusammensetzte; • Festlegung der Leitlinien des Projekts unter den Gesichtspunkten der Fauna, der menschlichen Aktivitäten im Wald und der Vorstellung vom Wald. Auf dieser Grundlage wurden 7 allgemeinen Grundsätzen für die Erneuerung der ökologischen Infrastruktur des Standorts definiert. | Die 2023 begonnenen Erneuerungsarbeiten am Standort Im Wald meines Herzens verliefen planmässig. Es wurden mehrere Massnahmen und Arbeiten durchgeführt, insbesondere die Einrichtung von Waldteichen und die Ausarbeitung der Begleittexte. Die Einweihung der neuen Infrastruktur fand am 24. Mai 2025 statt. | Da das Projekt Im Wald meines Herzens nun abgeschlossen ist, gilt es, neue Anwendungsbereiche für diese Massnahme zu identifizieren. | • Website Im Wald meines Herzens: https://auboisdemoncoeur.ch/ • Artikel in der Liberté «Nouvel écrin au Bois de mon coeur»: https://etatfr.sharepoint.com/sites/DIME-Intranet/Revue%20de%20presse%20DIME/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FDIME%2DIntranet%2FRevue%20de%20presse%20DIME%2FRevue%20de%20presse%20DIME%20RIMU%2027%2E05%2E2025%2Epdf&parent=%2Fsites%2FDIME%2DIntranet%2FRevue%20de%20presse%20DIME&p=true&ct=1755161423136&or=Outlook%2DBody&cid=6D292C11%2DEBE6%2D4688%2D9234%2D5E042B716E3A&ga=1&LOF=1 |
| B.1.2 | Berücksichtigung der Erfordernisse für Feuchtgebiete in Projekten, die das Pegelregime der Seen und den Wasserhaushalt der Fliessgewässer beeinflussen | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 75 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Marie Pichard | Der Klimawandel stellt für die in der Schweiz sowieso schon bedrohten Feuchtgebiete eine zusätzliche Bedrohung dar. Eine Arbeitsgruppe wird eingesetzt, die bestimmen soll, wie die Bedürfnisse von Feuchtgebieten in Projekten zur Ressource Wasser besser berücksichtigt werden können. | - | - | - | - | - | - | |
| B.1.3 | Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen des Klimawandels auf die lokale Biodiversität | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Über die im Kanton Freiburg besonders vom Klimawandel bedrohten Arten und Naturräume werden Studien und Monitorings durchgeführt (unter Berücksichtigung bereits existierender Studien). Anhand der Ergebnisse dieser Studien und Monitorings sollen konkrete, wirksame und gezielte Massnahmen durchgeführt werden. | - | - | - | - | - | - | |
| B.1.4 | Durchführung von Massnahmen zur Verringerung menschlicher Belastungen auf klimasensible Naturräume | 50% | 35% | Bevölkerung | 200 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2023-2026 | Marie Pichard | Der Klimawandel kann sich negativ auf die sensiblen Naturräume auswirken. Er kann aber auch zu einer Erhöhung ihrer Inanspruchnahme durch Freizeitaktivitäten führen (Wandern, Baden usw.), was zu einer erhöhten Störung der Fauna führt. Es werden Sensibilisierungs-, Überwachungs- und Unterhaltsmassnahmen durchgeführt, die es ermöglichen sollen, den menschlich bedingten Druck auf Naturräume, und dies insbesondere in hochfrequentierten Gebieten, zu begrenzen. | Das allgemeine Ziel dieser Massnahme ist es, ein Monitoring von Verstössen einzuführen, das von Naturbotschafterinnen und ‑botschaftern in den Naturschutzgebieten der Grande Cariçaie und in den an die Naturschutzgebiete angrenzenden Tourismusgebieten sicherstellt wird. Diese Personen sind mit folgenden Aufgaben betraut: • regelmässige Präsenz und Sichtbarkeit an den Standorten gewährleisten; • bei Bedarf Informationsmaterial verteilen und Fragen beantworten, um die Besucherinnen und Besucher zu informieren; • nach Möglichkeit Verstösse durch Aufklärungsarbeit verhindern; • die Interventionen protokollieren; • Daten für das Monitoring von Verstössen bereitstellen; • sich mit den Akteuren und Akteurinnen des Monitorings abstimmen. | - | - | Die «Naturbotschaft» wurde 2023 wie schon 2022 organisiert. Weil in diesem Jahr an einigen Stränden Animationen eingeführt wurden, konnten weniger Touren durchgeführt werden, doch blieb die Zahl der besuchten Gebiete und der Anteil der informierten Personen vergleichbar. Erfreulicherweise ist im Jahr 2023 deutlich weniger Verstösse gegen die Naturschutzgebietsreglemente zu verzeichnen. Diese positive Entwicklung muss in den nächsten Jahren bestätigt werden, ist aber wahrscheinlich das Ergebnis der in den letzten Jahren unternommenen Anstrengungen (Informationstafeln, Geländemarkierungen, polizeiliche Überwachung, Naturbotschafter/innen), um das gewünschte Gleichgewicht zwischen Naturschutz und Freizeitaktivitäten in Naturschutzgebieten zu erreichen. Dennoch bleibt die Zahl der Verstösse hoch, insbesondere in den seeseitigen Reservaten, die eigentlich für die Öffentlichkeit gesperrt sind, um die Erhaltung besonders empfindlicher Tierarten zu gewährleisten. Die Bemühungen zur Sensibilisierung der Besucherinnen und Besucher und zur Verbesserung der Beschilderung vor Ort müssen daher fortgesetzt werden. | Das Jahr 2024 wurde nach dem gleichen Prinzip wie 2023 organisiert, d. h. mit einem Team von 8 Personen, die von Mai bis September zu etwa 20 % beschäftigt waren. Die Motivation, Energie und Zufriedenheit der Botschafterinnen und Botschafter im Dienst der Erhaltung der Grande Cariçaie könnten grösser nicht sein. Aus operativer Sicht erwies sich das Jahr 2024 aufgrund des unbeständigen Wetters als sehr kompliziert. Die Botschafterinnen und Botschafter haben sich der Herausforderung gestellt und alle geplanten Aufgaben erfüllt. Die Besucherzahlen in den Naturschutzgebieten sind insgesamt gering, wobei die Zahl der Verstösse gegen die Vorschriften der Naturschutzgebiete mit derjenigen von 2023 vergleichbar ist. Durch die Erhöhung der Anzahl Standorte, die beaufsichtigt werden (von 17 im Jahr 2023 auf 39 im Jahr 2024), kann die Abdeckung des Gebiets für die Überwachung der Besucherzahlen und der Verstösse erhöht werden. Dank der zusätzlichen Daten, die von den Aufseherinnen und Aufsehern an drei Stränden erhoben wurden, und dank der Überwachung durch automatische Besucherzählstationen (Eco-Compteur) auf einigen Wegen in den Naturschutzgebieten ist es möglich, sich ein gutes Bild von der Nutzung der Naturschutzgebiete zu machen und die Kommunikations- und Überwachungsmassnahmen entsprechend anzupassen. | Am Ende der Saison 2024 hoben die Botschafterinnen und Botschafter keine Elemente hervor, die für 2025 wesentlich verbessert werden müssten. Es wurde jedoch beschlossen: • die Verwaltung der Verteilung von Dokumenten an die verschiedenen Einrichtungen vor Ort (Bars, Verleihstellen für Wassersportgeräte, Campingplätze usw.), die Informationen über die Grande Cariçaie weitergeben können, zu verbessern. Künftig wird zu Beginn jedes Monats ein systematischer Besuch dieser Einrichtungen organisiert, um sicherzustellen, dass alle Einrichtungen über die erforderlichen Informationen und Dokumente verfügen; • die naturkundliche Grundausbildung des Personals fortzusetzen, damit es seine Kenntnisse über Fauna und Flora erweitern kann. | • Tätigkeitsbericht Botschafter/innen 2023: https://grande-caricaie.ch/data/biblio_web_export_citavi/files/Le_Nedic_2024_Ambassadeurs_et_ambassadri.pdf • Website Grande Cariçaie: https://grande-caricaie.ch/de/startseite/ • Tätigkeitsbericht Botschafter/innen 2024: https://grande-caricaie.ch/data/biblio_web_export_citavi/files/Christophe_Le_Nedic_2025_Ambassadeurs_et.pdf |
| B.5.1 | Verbesserung der ökologischen Infrastruktur im urbanen und periurbanen Raum | 0% | 5% | Staat, Gemeinden, Bevölkerung | 500 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2023-2026 | Marie Pichard | Die Anpassungsfähigkeit der Natur an die neuen klimatischen Bedingungen in Stadtgebieten wird gefördert durch die Anpflanzung von an städtische Bedingungen und den Klimawandel angepasste Bäume und Sträucher, die Schaffung und Anpassung unversiegelter Grünzonen ökologischer Qualität im städtischen Gefüge sowie die Begrünung der Gebäude (Dächer und Fassaden). | Das allgemeine Ziel dieser Massnahme ist die Bewertung von Dächern mit Gemüsegärten mit biokohlebasierten Substraten und einem System zur Rückgewinnung von Regenwasser. | - | - | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: • die Einrichtung der Prototypen mit den verschiedenen Substraten • die Installation eines Systems zur Rückgewinnung von Regenwasser; • die Installation verschiedener Sensoren; • das über eine Saison durchgeführte Experiment mit Rucola-Anbau; • das Sammeln von Daten; • den Aussaat einer Pflanzendecke für den Winter. | Die Massnahme wurde für das Jahr 2024 ausgesetzt. | Die Massnahme wird eine wesentliche Unterstützung für das Aktionsportfolio zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsraum darstellen. | • Poster mit Erklärungen (April 2024): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/descriptif-et-resultatsavril-2024.pdf |
| B.5.2 | Schaffung und Renaturierung von Feuchtgebieten | 20% | 85% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen | 31 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2022-2026 | Marie Pichard | Proaktive Durchführung von Projekten zur Schaffung und Renaturierung besonders empfindlicher Feuchtgebiete auf staatseigenen Grundstücken im Rahmen der aktiven Bodenpolitik des Staats und Ermutigung der Gemeinden, dies ebenfalls zu tun | Das übergeordnete Ziel der Massnahme B.5.2 ist die Schaffung von Teichen und von Landlebensräumen sowie die ökologische Aufwertung des ausgewählten Gebiets. | - | Die Massnahme B.5.2 ermöglichte die Finanzierung der Vorstudie zum Projekt der Revitalisierung der Parzelle 487 der Gemeinde Murten (Sektor Galmiz), auf den Flächen ausserhalb des Waldes. Die Vorstudie wurde an ein externes Büro (Nouvelle fôret) vergeben. | Dieses Projekt wurde teilweise durch den kantonalen Klimaplan finanziert; die Finanzierung wurde für das Jahr 2023 pausiert. | Mit den verfügbaren Mitteln konnte zunächst eine Studie über die Auswirkungen der Biberpräsenz auf die Bibera finanziert werden. Die Studie wurde von einem Verein zum Schutz der Biber durchgeführt. Darüber hinaus ermöglichte die Massnahme die Ausarbeitung eines Konzepts zur Erhaltung der Populationen seltener Baumarten im Kanton und zu ihrer Wiederansiedlung. | Die Unterstützung von Renaturierungsprojekten in Feuchtgebieten soll fortgesetzt werden. | - |
| B.5.3 | Unterstützung von Projekten zur Revitalisierung von Fliessgewässern | 70% | 40% | Staat FR, Gemeinden | 700 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2026 | Paul Rwakabayiza | Unterstützung und Stärkung von Flussrevitalisierungsprojekten für Projekte, die ein besonderes Augenmerk auf die Anpassung an den Klimawandel richten. | Fliessgewässer und Feuchtgebiete reagieren besonders sensibel auf den Klimawandel und sind auch sehr stark von ihm betroffen. Das übergeordnete Ziel der Massnahme B.5.3 besteht darin, die Unterstützung für die Durchführung von Projekten zur Revitalisierung von Wasserläufen unter Berücksichtigung der Anpassung an den Klimawandel zu verstärken. | - | Die Umsetzung der Massnahme wurde 2022 auf zwei Hauptziele ausgerichtet: • Erstellung einer Typologie der Fliessgewässer des Kantons sowie Identifizierung der Risiken und Einflüsse des Klimawandels auf diese; • Ausarbeitung von Modellmassnahmen an der Glane bei Drognens (Siviriez) mit Monitoring nach ihrer Realisierung, um die Wirkung auf die Wassertemperatur zu beobachten. | Der Umfang der im Jahr 2022 eingeleiteten Aufträge wird erweitert. Die Überwachung und Dokumentation der Wirkung von Modellmassnahmen über mehrere Jahre wird durch ein neuer Auftrag sichergestellt. | Wie bereits in den Vorjahren setzt sich die Wirkung der an ausgewählten Flussabschnitten umgesetzten Modellmassnahmen fort. Auch im Bereich der Revitalisierung von Fliessgewässern und der Einbeziehung von Klimafragen in diese Thematik wird personelle Unterstützung geleistet. | Die Überwachung und Dokumentation der Wirkung von Modellmassnahmen wird fortgesetzt. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, werden auch andere Massnahmen im Zusammenhang mit Revitalisierungsprojekten unterstützt. | • Revitalisierung der Fliessgewässer und Seeufer: https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/wasser/seen-und-fliessgewaesser/renaturierung-der-gewaesser/revitalisierung-der-fliessgewaesser-und-seeufer |
| B.5.4 | Integration der klimatischen Herausforderungen in die rechtlichen und strategischen Grundlagen, die die Erhaltung der Biodiversität fördern | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Die Klimafrage ist Teil der Strategie Biodiversität des Kantons, die sich aktuell in Ausarbeitung befindet. Zudem werden die klimatischen Herausforderungen bei Aktionen berücksichtigt, die die Biodiversität fördern. | - | - | - | - | - | - | |
| B.5.5 | Bekämpfung der Verbreitung nicht einheimischer Arten | 50% | 15% | Gemeinden, Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2024-2026 | Marie Pichard | Der Klimawandel kann die Verbreitung nicht einheimischer Arten erleichtern, die der lokalen Fauna und Flora schaden. Daher werden die Massnahmen der Strategie zur Bekämpfung der Neobioten und die Umsetzung dieser Massnahmen unterstützt. Dies gilt insbesondere für die Massnahmen gegen den Verkauf, den Kauf und die Verbreitung dieser Arten. Des Weiteren wird die Forschung unterstützt, die die Verbindungen zwischen Klimawandel und invasiven gebietsfremden Arten untersucht. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme B.5.5 besteht darin, die Bekämpfung nicht einheimischer Arten finanziell zu unterstützen. | - | - | - | Durchführung von Arbeiten zur Bekämpfung des Japanischen Staudenknöterichs: Interventionen an mehreren Standorten der Forstgenossenschaft Forêts-Sarine. | Diese Interventionen sollen weiterhin unterstützt werden. | - |
| B.6.1 | Durchführung von Pilotprojekten zur Vernetzung von Biotopen | 0% | 25% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen | 209 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Umsetzung von Massnahmen zur Stärkung bestehender Vernetzungsgebiete und zur allgemeinen Stärkung der ökologischen Infrastruktur in Wäldern, Städten, auf Weiden, Wiesen und in Heckenlandschaften sowie zur Verbindung von Sümpfen, kleinen Wasserflächen und Wasserläufen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme B.6.1 besteht darin, den Gemeinden einen Leitfaden zur Anpflanzung von Bäumen in Siedlungsgebieten zur Verfügung zu stellen sowie die Schaffung von Wasserflächen zu ermutigen, die eine Vernetzung der Lebensräume ermöglichen. | Die Massnahme B.6.1 führte zu folgenden Ergebnissen: • Erstellung einer Liste von Bäumen, die an das zukünftige Klima angepasst sind und im Siedlungsraum gepflanzt werden sollen, sowie Informationen darüber, wie ein Baumbestand langfristig erhalten werden kann; • Pflanzung von 69 Bäumen aus dieser Liste in 62 Gemeinden, die Interesse an diesem Vorgehen zeigten; • Anlage eines neuen Teichs im Wald von Bouleyres neben einem bestehenden Teich, wodurch die Vernetzung der Feuchtgebiete in diesem Gebiet verstärkt wurde. | Die Massnahme B.6.1 führte zu folgenden Ergebnissen: • Abschluss der Massnahme nach den Verzögerungen bei der Durchführung bestimmter Arbeiten; • Abfassung eines an die Gemeinden gerichteten Leitfadens zum Thema Baumbestand im Siedlungsraum. | Im Jahr 2023 wurde der Leitfaden «Baumarten im Siedlungsraum und Klimawandel» veröffentlicht, der sich an die Gemeinden richtet. | Die Massnahme wurde für das Jahr 2024 ausgesetzt. | Die Massnahme ermöglicht die Finanzierung der Rodung einer Pappelreihe und die Neuanpflanzung einer vielfältigen Hecke im Seebezirk. | • Artikel «Ein Baum fürs Klima»: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/biodiversitaet/ein-baum-fuers-klima.html • Der Baumbestand im Siedlungsraum und Klimawandel: - Leitfaden für Gemeinden: https://www.fr.ch/de/document/500566 - Liste der Baumarten: https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-05/Liste_EssenceAvenir_DE.pdf |
Konsum und Wirtschaft

Das Hauptziel der Achse Konsum und Wirtschaft liegt in der Reduktion der indirekten Emissionen des Kantons Freiburg, sowie der direkten Emissionen aus der Industrie und der Baubranche. Die spezifischen Ziele der Achse Konsum und Wirtschaft sind die folgenden:
- Ermutigen des Privatsektors, seine Treibhaugasbilanz zu vermindern;
- Sensibilisieren der Bevölkerung in Bezug auf die Treibhausgas-Belastung des Konsums von Gütern und Dienstleistungen;
- Fördern von kurzen Lieferketten;
- Einwirken auf die Finanzanlagen des Staates und der Privatwirtschaft, um Praktiken zu fördern, die eine positive Auswirkung auf das Klima haben.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.1.1 | Unterstützung der Dachverbände bei der Kommunikation im Bereich der Reduktion von Treibhausgasemissionen | 0% | 0% | Vereinigungen, Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Gaël Berther | Den Dachverbänden Informationen über die mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen in ihrem Sektor zur Verfügung stellen. | Diese Massnahme will in erster Linie Unternehmen dabei unterstützen, die Ziele des Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG) zu erreichen, das am 1. Januar 2025 in Kraft treten wird und Unternehmen verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. | - | - | - | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Massnahmen verwirklicht: • Organisation eines Klima-Lunches zum Thema Klima und Unternehmen mit dem Ziel, die im Kanton ansässigen Unternehmen über die neuen gesetzlichen Verpflichtungen sowie über künftige Fördermöglichkeiten zu informieren; • Verfolgung der Entwicklungen im Zusammenhang mit dem KlG, insbesondere dessen im November 2024 veröffentlichter Ausführungsverordnung. | Für die weitere Umsetzung werden folgende Massnahmen erwartet: • Entwicklung eines Tools für die Erstellung von CO₂-Bilanzen für KMU im Kanton, um sie über ihre wichtigsten Emissionsquellen und bestehende Lösungen zur Verminderung zu informieren; • Start eines Pilotprojekts für einen Fahrplan auf individueller oder Branchenebene zur Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis 2050. | • Klima-Lunch Nr. 13: https://meinklimaplan.ch/freiburg/koerperschaften/staat-freiburg/unsere-klima-lunchs-1/klima-und-unternehmen.html | |
| C.1.2 | Vorbildliche Projekte zur Reduktion der Emissionen in Unternehmen fördern | 0% | 20% | Vereinigungen, Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2026 | Gaël Berther | Einen Pool vorbildlicher Projekte aus der Praxis in den verschiedenen Wirtschaftssektoren (Grossunternehmen und KMU) schaffen und verbreiten (Benchmarking von guten Praktiken bei der Emissionsreduktion in Unternehmen). | Das übergeordnete Ziel dieser Massnahme ist die Förderung in Unternehmen von vorbildlichen Projekten zur Emissionsverminderung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf bestehende Projekte gelegt, die ein grosses Verbreitungspotenzial haben. | - | Im ersten Jahr der Umsetzung finanzierte diese Massnahme den Abriss der CAFAG-Halle auf der Pérolles-Ebene mit dem Ziel, die Materialien wiederzuverwenden. | Diese Massnahme wurde 2023 nicht priorisiert. | Diese Massnahme wurde 2024 nicht priorisiert. | Für die weitere Umsetzung werden folgende Massnahmen erwartet: • Einrichtung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe (Kreislaufwirtschaft, Abfallwirtschaft und Klima), um künftige Umsetzungsmöglichkeiten zu identifizieren; • Beginn der Umsetzungsarbeiten entsprechend den von der Arbeitsgruppe identifizierten Möglichkeiten. | - | |
| C.1.3 | Sensibilisierung der Bevölkerung für die mit dem Konsum verbundenen Klimaauswirkungen | 110% | 85% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 140 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Aufgleisen einer Kampagne zur Sensibilisierung der Freiburger/innen für die mit dem Konsum verbundenen Klimawirkungen (Energie, nachhaltige Lebensmittel, Abfälle, Lebensmittelverschwendung usw.). Bei der Umsetzung der Massnahme wird besonders auf eine Sensibilisierung ohne Schuldzuweisung geachtet. | Das übergeordnete Ziel dieser Massnahme ist es, die verschiedenen Zielgruppen durch verschiedene Aktionen für ein verantwortungsvolles Konsumverhalten zu sensibilisieren. | - | - | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Massnahmen verwirklicht: • Start einer Partnerschaft mit dem Verein REPER im Rahmen des Labels «smart event» für den Kauf und die Bereitstellung von wiederverwendbarem Geschirr für Veranstaltungen mit Label; • Organisation des Klima-Lunches Nr. 11 zum Thema «Besser essen fürs Klima: eine Herausforderung für die Gemeinschaften?». | In Zusammenarbeit mit der FRC wurde eine Sensibilisierungskampagne gegen Lebensmittelverschwendung durchgeführt. Im Rahmen des Labels smart event für Veranstaltungen wurde eine Partnerschaft mit dem Verein REPER ins Leben gerufen, um Zugang zu wiederverwendbarem Geschirr zu Vorzugskonditionen zu ermöglichen. | Im Jahr 2025 soll die Partnerschaft mit dem Verein REPER fortgesetzt und die steigende Nachfrage nach wiederverwendbarem Geschirr bedient werden. | • Klima-Lunch Nr. 11: https://meinklimaplan.ch/freiburg/koerperschaften/staat-freiburg/unsere-klima-lunchs-1/besser-essen-fuers-klima-eine-herausforderung-fuer-die-gemeinschaften.html • Partnerschaft mit REPER: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/konsum-und-wirtschaft/originelle-und-kreative-tipps-gegen-verschwendung-um-im-alltag-selbst-hand-anzulegen.html • Wiederverwendbares Geschirr: https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/klima/news/wiederverwendbares-geschirr-zu-reduzierten-preisen-fuer-veranstaltungsorganisatoren | |
| C.2.1 | Unterstützung der Stiftung Carbon Fri und Ermutigung der Unternehmen, eine Kohlenstoffbilanz zu erstellen | 105% | 70% | Bevölkerung | 380 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Gaël Berther | Unterstützung der Stiftung Carbon Fri und Förderung derselben bei den Unternehmen. Ermutigung und Unterstützung von Unternehmen, den Prozess Carbon Fri in die Wege zu leiten und eine CO₂-Bilanz zu erstellen. | Die Umsetzung der Massnahme C.2.1 umfasst mehrere Schwerpunkte. Der erste besteht darin, die Privatunternehmen des Kantons bei der Erstellung einer CO₂-Bilanz zu unterstützen, damit sie ihren ökologischen Fussabdruck verkleinern und das Label Carbon Fri erhalten können. Im Anschluss an die CO₂-Bilanz werden auch eine Abfallbilanz und ein Workshop zu Mobilitätsplänen angeboten. Schliesslich gehört auch die Entwicklung eines CO₂-Rechners für Privatpersonen zu den Zielen der Massnahme. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Auszeichnung von 24 Unternehmen im Laufe des Jahres mit dem Label; • Ausbau der Kommunikation über die Massnahmen der Stiftung (Interviews, Videos, Medienmitteilungen, soziale Netzwerke, Wettbewerbe); • Entwicklung des Online-Tools zur CO₂-Berechnung. Der Rechner (der mit der Datenbank von Climate Services in Verbindung steht) wurde bereits für den Teil Tourismus/Reisen lanciert. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • 16 neue Unternehmen erhielten das Label, womit es seit Beginn der Umsetzung insgesamt 40 Unternehmen sind. • Das Angebot der Abfallwirtschaftsbilanz war hingegen nicht so erfolgreich, wie erhofft. • In Bezug auf die Mobilitätspläne wurde nach einer Analyse entschieden, den Unternehmen einen Workshop anstelle der finanziellen Unterstützung anzubieten. Eine solche finanzielle Unterstützung hat nämlich angesichts der hohen Kosten für einen Mobilitätsplan keinen Einfluss auf die Entscheidungsfindung eines Unternehmens. Der erste Workshop fand Anfang 2023 statt und war ein grosser Erfolg. • Die Entwicklung eines Online-CO₂-Berechnungstools auf interkantonaler Ebene wurde untersucht, was zu einer Verzögerung bei der Entwicklung des Tools führte, aber eine umfassendere Reflexion ermöglichte. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • 6 Unternehmen haben 2023 von der Unterstützung für die Erstellung ihrer CO₂-Bilanz profitiert, 5 weitere Unternehmen (die 2023 angesprochen wurden) werden noch 2024 Anspruch darauf haben. • Die Kommunikation über Carbon Fri wurde das ganze Jahr über durch Events unter dem Label Café #2030, soziale Netzwerke und die Medien fortgesetzt. • Es fanden 2 Workshops für Mobilitätspläne statt, die ein grosser Erfolg waren. • Der CO₂-Rechner 2.0 wurde entwickelt und online gestellt. Die Kommunikation zum neuen Rechner hat sich verzögert, wird aber in Zusammenarbeit mit dem Klimaplan im Frühjahr starten. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Erstellung eines Videos zur Vorstellung der ausgewählten Projekte für 2024; • Produktion von Bildmaterial für soziale Netzwerke und Analyse der Relevanz der Nutzung verschiedener Plattformen (Verzicht auf Facebook); • bezahlte Werbekampagnen für Carbon Fri; • Organisation des Café #2030 am 11. September 2024 unter Beteiligung der EnAW zur Information über Zielvereinbarungen (15 teilnehmende Unternehmen); • Organisation eines Workshops zu Mobilitätsplänen am 31. Oktober 2024 (11 teilnehmende Unternehmen); • Organisation und Kommunikation zur CSR-Schulung am 7. Juni 2024, die von der HIKF durchgeführt und von Carbon Fri gesponsert wurde (9 teilnehmende Unternehmen); • Werbekampagne für das Label Carbon Fri bei Akteuren der Tourismusbranche; im Anschluss an diese Kampagne haben vier Tourismusbüros positiv reagiert und sich zur Teilnahme an der Carbon-Fri-Zertifizierung verpflichtet; • Erstellung von 6 Newslettern und Versand an über 600 potenzielle Kundinnen und Kunden; • Organisation eines Wettbewerbs (zwischen September und Dezember) zur Förderung der Nutzung des CO₂-Rechners. • Organisation des Wirtschaftsforums für nachhaltige Entwicklung am 28. November 2024 (140 Teilnehmende). | Für 2025 ist Folgendes geplant: • Hosting des CO₂-Rechners; • Unterstützung von drei Schulungen der HIKF im Bereich Nachhaltigkeit (Ökodesign, rechtlichen Normen CSRD/KlG, digitale Nachhaltigkeit); • Organisation von drei Café #2030 (im Februar, Juni und September) in Zusammenarbeit mit Swiss Triple Impact (STI); • Werbung in sozialen Netzwerken; • Aktualisierung eines Präsentationsvideos zu Carbon Fri; • Versand von Newslettern an die HIKF-Community; • Überlegungen zur Anpassung des Carbon-Fri-Zertifizierungsmodells an die neuen gesetzlichen Anforderungen für Unternehmen. | • Website von Carbon Fri: https://carbonfri.ch/ • Fragebogen zur Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wirtschaftsforums für nachhaltige Entwicklung | |
| C.2.2 | Unterstützung der Förderung und Valorisierung der Ressource Holz | 110% | 95% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen | 80 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2023-2026 | Gaël Berther | Unterstützung von Aktionen zur Förderung und Valorisierung der Ressource Holz (Energie, Möbel, Baubranche, usw.), um den Gebrauch von Produkten zu fördern, die zur Kohlenstoffspeicherung beitragen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme C.2.2 ist in verschiedene Projekte gegliedert, die sich in den verschiedenen Jahren der Umsetzung unterscheiden werden: • 2023 ging es darum, die Beitragsgesuche der Unternehmen im Zusammenhang mit der neuen Verordnung über die Gewährung einer Prämie für die Verwendung von Holz (gültig bis Ende 2023) zu beantworten. • Ab 2024 und in den folgenden Jahren der Umsetzung wird es darum gehen, die Laubholzproduktion zu stärken, um die wirtschaftliche Funktion der Wälder unter Berücksichtigung des Klimawandels zu gewährleisten. | - | - | Für das erste Jahr der Umsetzung wurde beschlossen, die Nutzung von Freiburger Holz im Bauwesen zu fördern und aufzuwerten, um den Verbrauch von Produkten, die zur Kohlenstoffspeicherung beitragen, durch die Gewährung eines individuellen Beitrags im Sinne von Artikel 5 des Subventionsgesetzes (SubG) zu fördern. Im Rahmen der verfügbaren Mittel kann jedes Unternehmen, das ein Gesuch stellt, einen Beitrag erhalten, wenn es: • für seine Projekte Freiburger Holz als Baumaterial verwendet; und • seinen Sitz im Kanton Freiburg hat. Es werden nur die 2022 eingereichten Gesuche berücksichtigt, die die Bedingungen der Verordnung über die Gewährung einer Prämie für die Verwendung von Holz aus dem Kanton Freiburg auf dem Bau erfüllen, die am 31. Dezember 2022 ausgelaufen ist, und die von LIGNUM FRIBOURG/FREIBURG validiert wurden. Die Höhe des Beitrags beträgt 10 % der Anschaffungskosten des im Bauprojekt verwendeten Holzprodukts, höchstens jedoch 10'000 Franken. Insgesamt konnten 15 Projekte, die von 8 verschiedenen Unternehmen durchgeführt wurden, finanziell unterstützt werden. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Verbreitung der Liste der zu fördernden Laubbaumarten unter den Försterinnen und Förstern; • Unterstützung der Försterinnen und Förster bei der Waldplanung (z. B. Empfehlungen des WNA an die Forstbezirke, die Gesuche für beitragsberechtigte Baumarten stellen); • Unterstützung der Försterinnen und Förster bei der Planung von Pflanzungen; • Unterstützung einer Kommunikationsmassnahme für die breite Öffentlichkeit zur Förderung und Aufwertung der Ressource Holz im Rahmen des MurtenLicht Festivals (Arteplage Sapin). | Für die weitere Umsetzung ist Folgendes geplant: • Einrichtung einer Task-Force, um fundierte Stellungnahmen zu forstwirtschaftlichen Fragen abzugeben. | • PrämHolzV: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/821.40.54 | |
| C.2.3 | Unterstützung bei der Kontrolle von Anlagen mit Kältemitteln | 100% | 65% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 170 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2025 | Quentin Pointet | Gewisse Kältemittel haben ein hohes Treibhauspotenzial. Die Kontrolle der Konformität und Dichtheit der Anlagen, die diese Mittel ausstossen können, wie Kühlschränke, Klimaanlagen und Wärmepumpen, wird unterstützt. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme C.2.3 ist es, die Konformität möglichst vieler Kältemittelanlagen mit den Vorgaben der ChemRRV zu überprüfen. | - | - | Die Kontrollen begannen im September nach einer dreimonatigen Vorbereitungsphase für das Verfahren und die Planung. Insgesamt wurden 303 Anlagen kontrolliert. 238 Anlagen (78 %) wiesen Nichtkonformitäten auf, davon 62 erhebliche Nichtkonformitäten (nicht konformes Inverkehrbringen, fehlende Dichtheitskontrollen, wiederkehrende, nicht korrigierte Lecks). Auf der Grundlage der gesammelten Daten wird geschätzt, dass: • die Gesamtheit der kontrollierten Anlagen 28'874 Tonnen CO₂-Äquivalente enthält; • sich die gemeldeten Lecks auf 14'447 Tonnen CO₂-Äquivalente belaufen; • das Durchschnittsalter der kontrollierten Anlagen 14 Jahre beträgt. In erster Näherung entsprechen die Lecks mindestens 1032 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr für die kontrollierten Anlagen. | Ende 2024 waren im Kanton Freiburg 8038 Anlagen offiziell als in Betrieb registriert. Die darin enthaltenen Gasmengen summieren sich auf 249'644 Tonnen CO₂-Äquivalenten. Im Jahr 2024: • wurden 1044 Anlagen mit 84'866 Tonnen CO₂-Äquivalenten inspiziert; • wiesen 144 Anlagen (14 %) erhebliche Mängel auf (nicht konformes Inverkehrbringen, fehlende Dichtheitskontrollen, wiederkehrende, nicht korrigierte Lecks). Mit Blick auf die Umwelt lassen sich folgende Auswirkungen feststellen: • Über die Lecks, die seit Beginn der Kampagne in den Wartungsheften der inspizierten Anlagen dokumentiert wurden, gelangten 27'802 Tonnen CO₂-Äquivalente in die Umwelt. • Das Durchschnittsalter der kontrollierten Anlagen beträgt 16 Jahre. • In erster Näherung entsprechen die Lecks in den kontrollierten Anlagen seit 2023 mindestens 1'737 Tonnen CO₂-Äquivalenten pro Jahr. | Fortführung der Kontrollen der Kältemittelanlagen. Die Priorität der Inspektionen richtet sich nach dem Risiko (Menge an CO₂-Äquivalenten, Alter). Die Wärmepumpen, insbesondere solche, die erst kürzlich montiert und in der Fabrik hergestellt wurden, werden nachrangig kontrolliert. | - | |
| C.2.4 | Förderung des lokalen Tourismus sowie der Produkte aus dem Freiburgerland | 90% | 95% | Vereinigungen, Bevölkerung | 250 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Térésa Lefèvre | Projekte zur Förderung des lokalen Tourismus sowie der Produkte aus dem Freiburgerland werden unterstützt, damit die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Freiburg ihre Freizeit in der nahen Umgebung verbringen und die hiermit verbundenen Wegstrecken begrenzen können. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme C.2.4 ist es, Projekte zu unterstützen, die den lokalen Tourismus und regionale Produkte fördern, um indirekte Emissionen durch Reisen ins Ausland zu vermeiden und direkte Emissionen durch Konsummuster zu reduzieren; betrifft die Mobilität und/oder die Ernährung. Um dies zu erreichen, ist die Massnahme in 4 Schwerpunkte unterteilt: • A: Verbesserung der Erreichbarkeit von Sehenswürdigkeiten durch nachhaltige Mobilitätsmittel; • B: Schaffung innovativer Lösungen für sanfte Mobilität; • C: Kanalisierung der Touristenströme und Sensibilisierung; • D : Treibhausgasbilanzen von touristischen und regionalen Produkten. Die Schwerpunkte A und B werden in Partnerschaft mit dem Freiburger Tourismusverband umgesetzt, der Schwerpunkt C mit dem Regionalen Naturpark Gruyère-Pays d’en Haut und der Schwerpunkt D mit Terroir Fribourg und dem Freiburger Tourismusverband. Ein besonderes Augenmerk wird während der gesamten Umsetzung auf die Suche nach Synergien zwischen den verschiedenen Schwerpunkten der Massnahme gelegt. | Schwerpunkt A: Verbesserung der Erreichbarkeit von Sehenswürdigkeiten durch nachhaltige Mobilitätsmittel; •Diskussionen mit den Freiburgischen Verkehrsbetrieben (TPF), um die Projekte zur Entwicklung neuer Bahnhöfe kennenzulernen, mit dem Ziel, eine Studie zu lancieren, in der in Erwartung der Entwicklung von Grossprojekten die Möglichkeiten der touristischen Erschliessung der Hubs durch den öffentlichen Verkehr geprüft werden; • Unterstützung der Lancierung des Labels «Swisstainable»; Schwerpunkt B ist in zwei Unterpunkte aufgeteilt. Bei diesem Schwerpunkt konnte aufgrund des ersten Teilprojekts: • die Kommunikation über die Vorteile multimodaler Lösungsstrategien bei Ausflügen ab den «Hubs» (Zug- und Bushaltestellen) in die Kommunikationskampagne der Region Freiburg vom Herbst integriert werden; • die Erstellung von Treibhausgasbilanzen für Ausflüge gefördert werden; Das zweite Teilprojekt von Schwerpunkt B hat seinerseits Folgendes ermöglicht: • Beteiligung an der Ausarbeitung des Entwurfs für ein neues Gesetz über den Tourismus, das mit dem neuen Mobilitätsgesetz koordiniert wird; • Lancierung des Projekts «Schaffung eines offiziellen kantonalen Mountainbike-Netzes» mit Aufstellung eines Inventars und Bildung einer Interessengemeinschaft; • Aufnahme von Gesprächen mit Groupe E über die Möglichkeiten, Ladestationen für MTB im Netz zu installieren; Der Schwerpunkt C (Projekt «Vounetz») betrifft die Kanalisierung der Touristenströme und die Sensibilisierung für dieses Thema. Er umfasst Folgendes: •Bereich Informationspunkt des Parks; •Sensibilisierung für die Störung von Wildtieren; Schwerpunkt D hat zum Ziel, Treibhausgasbilanzen von touristischen und regionalen Produkten zu erstellen. Folgendes wurde erreicht: • Erstellung von zwei Bilanzen: eine für Erdbeeren und eine für Spargel. Diese Arbeiten wurden von den Büros projets21 und Climate Services in Zusammenarbeit durchgeführt; • Durchführung einer Kommunikationskampagne zu den Vorteilen des lokalen Konsums | Die Massnahme erlaubte die Realisierung der folgenden Etappen: Schwerpunkt A: •Klausuren, die zum Ziel hatten, die TPF bei konkreten Ansätzen für den Transport von Mountainbikes im Bus zu begleiten; •Einrichtung eines kombinierten Schalters SBB/TPF in Bulle, was für die Passagier das Umsteigen erleichtert; •Planung durch die TPF einer Erweiterung des Busangebots insbesondere für Les Paccots und Schwarzsee. Schwerpunkt B: •Es wurden 50 prioritäre Standorte für die Installation von Ladestationen für E-Mountainbikes festgelegt. •In Abhängigkeit vom Standort der Ladestationen und der geplanten Nutzung dieser Standorte werden 3 Arten von Prototypen von Ladestationen untersucht. • Es ist geplant, alle Hauptorte mit Ladestationen auszustatten. Schwerpunkt C: • Das Projekt «Vounetz», Eine Saison auf der Alp, wurde abgeschlossen. Aufgrund des Erfolgs könnte die gleiche Art von Projekt auch in anderen Stationen des Kantons entwickelt werden. Schwerpunkt D: •Die Kampagne zur Förderung des Konsums von lokalen Erdbeeren und zur Sensibilisierung der Bevölkerung für die CO₂-Belastung durch den Verzehr von Erdbeeren ausserhalb der Saison wurde erfolgreich reaktiviert. •Es wurde eine CO₂-Bilanz für Freiburger im Vergleich zu brasilianischem Poulets erstellt. • Es wurde eine CO₂-Bilanz über den Realisierungsprozess der Marketingkampagne «Herbst und Genuss» in Zusammenarbeit mit Terroir Fribourg erstellt. | Massnahme C.2.4 führte zu folgenden Ergebnissen: Für Schwerpunkt A: • Arbeit am Mobilitätsgesetz: Überprüfung der offiziellen Routen (Wandern/Mountainbiking/Schneeschuhwandern) und Legalisierung dieser Strecken; • Zusammenarbeit mit den TPF, neue Teststrecken zwischen Jaun und Boltigen und Projekt für Veloträger auf den TPF-Bussen mit Genoud B Sàrl (Test eines Anhängers in der Region Jaun). Für Schwerpunkt B: • Ladestationen: Fortsetzung der Gespräche mit den Anbietern, Erweiterung des Kreises der potenziellen Anbieter; • Erhalt einer NRP-Unterstützung (Anreize der WIF), um die Ausrüstung der touristischen Leistungsträger zu fördern und den Freiburger Abschnitt der nationalen Mountainbike-Route Nr. 2 Panorama Bike (Zollhaus – Les Paccots) zu sanieren und zu verbessern. Für Schwerpunkt C: • 2023 sollte ein Projekt mit den Bergbahnen von Jaun durchgeführt werden. Weil diese sich nicht auf ein konkretes Projekt festlegen konnten, kam diese Zusammenarbeit nicht zustande. In diesem Jahr wurden die für 2024 geplanten Massnahmen festgelegt. Für Schwerpunkt D: • Die Kampagne zur Förderung des Konsums von lokalen Erdbeeren wurde von Mitte April bis Mitte Mai erfolgreich reaktiviert. • Die Kommunikationskampagne «Schweizer Poulet vs. brasilianisches Poulet» wurde von GastroFribourg (erreichte 2'000 Gastwirte, davon ¼ Gemeinschaftsküche, ¼ italienische Küche, ¼ chinesische Küche, ¼ andere) und direkt von Terroir Fribourg (erreichte 50 Betriebe) verbreitet. Es wurde ein Newsletter (ein einminütiger Infografikfilm) über die CO₂-Bilanz veröffentlicht; zudem wurden Flyer verteilt und es gab eine Weiterverbreitung auf den sozialen Netzwerken von Terroir Fribourg (LinkedIn) sowie auf der Plattform Mein Klimaplan und den sozialen Netzwerken des Staats Freiburg; • Es wurde die CO₂-Bilanz eines Weichkäses mit dem Label «Fribourg – regio.garantie» im Vergleich zu der eines französischen Käses erstellt. Die Ausarbeitung von Infografiken und der Start der Kommunikationskampagne sind für 2024 geplant. | Die Umsetzung der Schwerpunkte A und B ermöglichte die Durchführung einer Studie zur Verbesserung der Aufnahmebedingungen bei den Drehscheiben des öffentlichen Verkehrs. Die Studie umfasst einen Katalog bewährter Praktiken und ermöglichte es ausserdem, 7 vorrangige Drehscheiben mit konkreten Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Die Umsetzung des Schwerpunkts B ermöglichte die Unterstützung von drei Projekten. Zunächst wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein «Amicale du sentier botanique» und dem Botanischen Garten Freiburg der Botanische Pfad Moléson restauriert, d. h. es wurden neue Schilder angefertigt, die im Frühjahr 2025 aufgestellt werden sollen. Darüber hinaus beteiligt sich der Park an einem Projekt zur touristischen Erschliessung eines Wanderwegs in Montbovon, das die Anbringung von 17 Informationstafeln zum Kulturerbe und einen Vorschlag für eine Schnitzeljagd in virtueller Realität zum Thema Kulturerbe umfasst. Schliesslich hat der Park das Projekt «Letzte Hoffnung» in Jaun unterstützt, bei dem Hinweisschilder zur Störung der Tierwelt in den Bergen entwickelt wurden. Die Umsetzung des Schwerpunkts D bestand in der Kampagne zur Förderung des Konsums von lokalen anstelle von importierten Erdbeeren, die vor der Saison auf dem Markt angeboten werden. Die Kampagne umfasst die Verteilung von Flyern (Bäckereien und Einkaufszentren), Publikationen sowie Presseartikel. | 2025 ist für die Schwerpunkte A und B ist vorgesehen, die Studie fortzusetzen und mit der Begleitung der freiwilligen Gemeinden zur Verbesserung der Drehscheiben für multimodale Mobilität zu beginnen, insbesondere in Abstimmung mit den TPF. Was den Schwerpunkt B betrifft, wird der Park seine Zusammenarbeit bei den drei 2024 begonnenen Projekten fortsetzen. Die Kampagne Erdbeeren (Schwerpunkt D) wird neu aufgelegt werden. | • Kampagne Erdbeeren: https://www.terroir-fribourg.ch/de/communication/blog/campagne-fraises • Kampagne Poulet: https://www.terroir-fribourg.ch/de/produits/produits-phares/poulet-regional • Projekt «Vounetz»: https://www.charmey.ch/de/aktivitaeten/die-alpsaison/ & https://www.gruyerepaysdenhaut.ch/_Resources/Persistent/a063be92b79d3d988a453a5f86835408404c9a59/Parc%27info%2027.pdf | |
| C.3.1 | Erhöhung der Investitionen und Finanzströme zugunsten des Klimas | 0% | 0% | Staat FR | 30 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Gaël Berther | Um die staatlichen Investitionen stärker mit den Zielen des Übereinkommens von Paris in Einklang zu bringen, werden in den Auftragsschreiben für Vertreter und Vertreterinnen des Staates in öffentlich-rechtlichen Einheiten, an deren Kapital er beteiligt ist, Klimafragen im Rahmen der Umsetzung der Strategie zur Steuerung staatseigener Betriebe integriert. Darüber hinaus werden bei Bedarf die Bemühungen des Vorstands der PKSPF zur Integration von Klimafragen (ESG-Analyse, Teilnahme an ETHOS-Programmen usw.) unterstützt. Ferner beteiligt sich der Verantwortliche des Klimaplans am ETHOS-Diskussionsprogramm. | Die Massnahme C.3.1 hat das Hauptziel, für die Vertreterinnen und Vertreter des Staats in den öffentlich-rechtlichen und den privatrechtlichen Unternehmen, an deren Kapital der Staat beteiligt ist, Auftragsschreiben auszuarbeiten, welche die klimatischen Herausforderungen in die Umsetzung der Public-Corporate-Governance-Strategie integrieren. | Im Rahmen der Massnahme C.3.1 wurde eine Liste von Zielen für folgende Themen entwickelt: • Umwelt und Klima; • Ethik und soziale Verantwortung; • Unternehmensfinanzen; • öffentliche Aufgaben; • kantonale Wirtschaft. | Die Vorlage für Auftragsschreiben wurde erstellt. | Im Rahmen der Umsetzung der Strategie der Public Corporate Governance werden Auftragsschreiben, die unter anderem die Herausforderungen der Nachhaltigkeit umfassen, für alle Vertreterinnen und Vertreter des Staats in den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Unternehmen erstellt. Die Auftragsschreiben mit Nachhaltigkeits- und Klimazielen wurden erstellt. Diese Massnahme gehört zu den laufenden Aufgaben des Amts. Es können Verbesserungen vorgenommen werden, aber die Massnahme führt zu einer strukturellen Veränderung. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Bereitstellung des Kriterienkatalogs in AXIOMA zur Erstellung von Auftragsschreiben; • Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien in bestimmte Auftragsschreiben. | Für die weitere Umsetzung werden folgende Ansätze geprüft: • Einrichtung einer Überwachung der Integration der Nachhaltigkeits- und Klimakriterien in die verschiedenen Auftragsschreiben; • offizielle Mitteilung an die Generalsekretäre über die Arbeit der Arbeitsgruppe; • Sondierung des Interesses und der Synergien mit möglichen Massnahmen der Biodiversitätsstrategie. | - | |
| C.3.2 | Stärkung der klimatischen Kriterien bei öffentlichen Investitionen und öffentlichen Ausschreibungen des Staates | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 50 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Einsetzung einer Arbeitsgruppe, mit der Aufgabe, Wege zu ermitteln, wie klimatische Kriterien in öffentliche Investitionen und öffentliche Ausschreibungen des Staates integriert und stärker gewichtet werden können. | - | - | - | - | - | - | ||
| C.4.1 | Förderung des Recyclings von Altölen zur Herstellung von Biokraftstoff | 0% | 0% | Staat FR, Gemeinden | 30 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2026 | Gaël Berther | Anpassung der Gesetzgebung, um das Recycling von Altölen im Hinblick auf ihre Verwendung als Biokraftstoff zu fördern, um nicht nur die Verwertung von Speiseölen aus Restaurants, sondern auch von auf Abfalldeponien gesammelten Ölen zu ermöglichen. | Altspeiseöl, das in den kommunalen Sammelstellen gesammelt wird, gilt als Sonderabfall. Die Entsorgung erfolgt derzeit in Verbrennungsanlagen oder Zementwerken, wo ein Teil des Energiepotenzials genutzt wird. Nun soll die Möglichkeit geprüft werden, das Altspeiseöl stattdessen für die Herstellung alternativer Kraftstoffe zu verwenden, wie es für die gleiche Art von Abfall aus der Gastronomie erlaubt ist. | - | Das Amt für Umwelt hat erste Gespräche mit einem Unternehmen aus der Region geführt, das Biokraftstoffe herstellt, um die technische Möglichkeit der Verwendung von Altöl zur Herstellung von Biokraftstoff zu prüfen. | Es wurden Überlegungen zu den Auswirkungen dieser Massnahme auf das Klima angestellt, insbesondere mit Blick auf die Prozesse für den Emissionsausgleich im Bereich der Biokraftstoffproduktion. | Es wurde eine erste Analyse der Produktqualität durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass es Probleme hinsichtlich der Konformität der Anlagen gibt. Daher wurde der Konformität dieser Anlagen Vorrang eingeräumt, was Fortschritte bei der Umsetzung dieser Massnahme verhindert hat. | Bis zur Herstellung der Konformität der Anlagen werden Überlegungen angestellt, um andere Möglichkeiten zur Umsetzung dieser Massnahme zu prüfen. | - |
Wasser
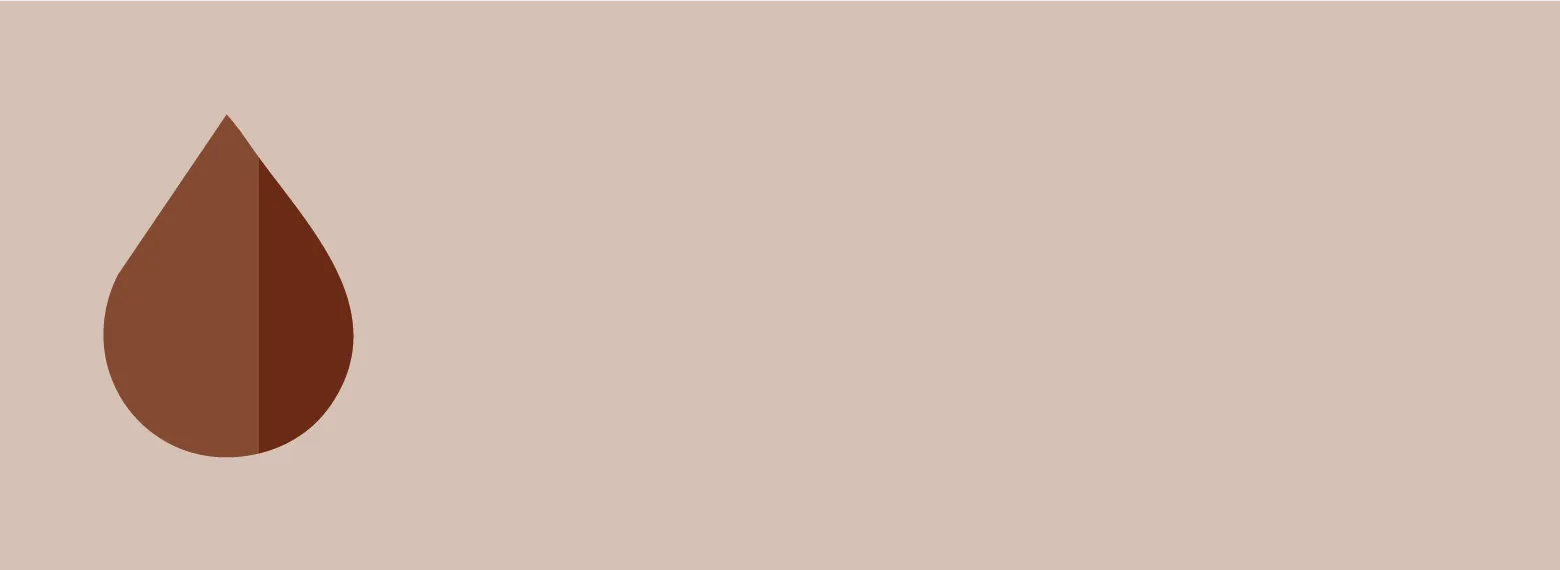
Das Hauptziel der Achse Wasser besteht darin, das Wasser für die verschiedenen Nutzungen und Bedürfnisse im Kanton verfügbar zu machen. Diese Massnahmen ermöglichen es zudem, die klimatischen Herausforderungen beim Management der Wasserressourcen für die verschiedenen Bedürfnisse und Nutzungen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die Wasserkraft, die Landwirtschaft und den täglichen Wassergebrauch. Die spezifischen Ziele der Achse Wasser sind:
- Erarbeiten von Szenarien hinsichtlich der Entwicklung der Verfügbarkeit der Wasserressourcen;
- Bewirtschaften der Wasserressourcen in einer durchdachten, nachhaltigen und wirtschaftlichen Weise unter Wahrung eines Gleichgewichts zwischen Nutzungen und verfügbaren Ressourcen;
- Verhindern und bekämpfen der Verschlechterung der Wasserqualität, da dies die aquatischen Lebensräume und/oder die menschliche Gesundheit negativ beeinflussen kann.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W.1.1 | Evaluation der Konsequenzen der Szenarien Hydro-CH2018 auf die Wasserressourcen | 70% | 85% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 110 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2025 | Paul Rwakabayiza | Evaluation der Szenarien Hydro-CH2018 und Übertragung auf den Kanton Freiburg; Evaluation der Auswirkungen der neuen Szenarien auf die Wasserressourcen des Kantons (oberirdische Gewässer, unterirdische Gewässer) und deren Verwendung; Kommunikation der Risiken, des Handlungsbedarfs und der vorgesehenen Aktivitäten. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W.1.1 besteht darin, klimatische und hydrologische Projektionen für die verschiedenen Regionen des Kantons Freiburg zu erstellen, um die Auswirkungen auf das Gebiet zu identifizieren, insbesondere in Bezug auf die Wasservorkommen (W.1.1) und den Hochwasserschutz (W.5.1). | - | Die Massnahme W.1.1 wird parallel zur Massnahme W.5.1 durchgeführt, die im Vorjahr begonnen wurde. Die Begleitung der Studie, die 2021 über die Massnahme W.5.1 eingeleitete wurde und das Ziel verfolgt, die klimatischen und hydrologischen Szenarien auf die Ebene der Einzugsgebiete des Kantons zu entwickeln und zu übertragen, wurde 2022 im Rahmen der Massnahme W.1.1 durchgeführt. | Die nationalen Klima- und Abflussprojektionen werden für den Kanton Freiburg auf die Regionen heruntergebrochen (Grosses Moos, Untere Broye, Mittelland Nord, Mittelland Süd, Voralpen) und in einem technischen Bericht dargestellt. Die Ergebnisse werden den beteiligten Ämtern und Sektionen im Sommer 2023 vorgelegt. Weil sich dieser Bericht hauptsächlich an Fachleute für Raumplanung und Naturgefahrenmanagement richtet, wird an der Erstellung einer Broschüre für die Gemeinden und die Bevölkerung gearbeitet. Diese wird die wichtigsten klimatischen und hydrologischen Veränderungen zusammenfassen, die für den Kanton bis zum Ende des Jahrhunderts zu erwarten sind, je nach Umfang der Klimaschutzmassnahmen, die auf globaler Ebene umgesetzt werden. | Ziel der laufenden Arbeiten ist die Veröffentlichung einer Broschüre und eines technischen Berichts, die die Klima- und Hydrologieprognosen für die Regionen des Kantons Freiburg aufzeigen. | Die Veröffentlichung ist auf Anfang 2025 angesetzt. Im Fokus stehen die praxisnahe Nutzung der Resultate in den betroffenen Bereichen sowie die Überarbeitung des Teils der kantonalen Klimastrategie, der die Anpassung behandelt. | • Neue Schweizer Klimaszenarien CH2018: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/neue-schweizer-klimaszenarien-ch2018.html • Hydro-CH2018 Forschungsprojekte: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/hydro-ch2018/hydro-ch2018-forschungsprojekte.html • Wie wird sich das Klima im Kanton in den nächsten Jahrzehnten entwickeln?: https://www.fr.ch/de/rimu/afu/news/wie-wird-sich-das-klima-im-kanton-in-den-naechsten-jahrzehnten-entwickeln |
| W.1.2 | Monitoring der Oberflächengewässer unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels (hydrometrisches und quantitatives Monitoring sowie Vorhersagen) | 145% | 70% | Staat FR | 300 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2026 | Paul Rwakabayiza | Ausbau des Monitorings der Oberflächengewässer (Quantität) und Nutzung bereits erfasster Daten; Ausbau und Modernisierung des Vorhersage-Webportals (Hoch- und Niedrigwasserabfluss) und Implementierung eines Warn- und Alarmsystems. | Die hydrometrische Überwachung der Flüsse im Kanton wird verstärkt und die Vorhersage des Abflusses verbessert. | - | - | Es werden Massnahmen eingeführt, um die hydrometrische Überwachung der Wasserläufe des Kantons zu verbessern. Das Amt für Umwelt beschafft das Material, das für die Einrichtung von drei neuen hydrometrischen Stationen (Messung des Wasserstands und der Wassertemperatur) erforderlich ist. Parallel dazu wird neues Material für die Abflussmessung mit Tracern (Salze, Fluoreszeine) angeschafft. | Es werden verschiedene Massnahmen durchgeführt, darunter: • Verdichtung des kantonalen hydrometrischen Netzes (4 zusätzliche Messstationen); • Anschaffung neuer moderner Messgeräte (manuelle Messungen); • Hinzufügen von Temperaturmessungen (Sonden, die den Wasserstand wie auch die Temperatur messen) an den kantonalen Abflussmessstationen; • Einrichtung eines Pilotprojekts für eine Temperaturmessstation in Zusammenarbeit zwischen dem BAFU und dem AfU; • Stabilisierung des Flussbetts (Blockwurf) für zwei Stationen, um die Abflussmessungen zu verbessern, ohne dabei die Fischwanderung zu beeinträchtigen; • Verbesserung der hydrologischen Vorhersagen (Schutz vor Hochwasser und Dürren); • Verbesserung der Datenverarbeitung; • Stärkung des interkantonalen Austauschs. | Die Ziele für die Zukunft gründen hauptsächlich auf: • der Fortsetzung der automatischen und manuellen Abflussmessungen; • der Arbeit im digitalen Bereich (Datenverarbeitung und Einrichtung einer neuen öffentlichen Website); • der Stabilisierung des Flussbettes auf der Grundlage der Erfahrungen mit den beiden stabilisierten Stationen; • der Verbesserung der Abflussprognosen. | - |
| W.1.3 | Monitoring und Grundwasserbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels | 200% | 80% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2026 | Gijs Plomp | Studie über die Auswirkungen der Szenarien Hydro-CH2018 auf die unterirdischen Gewässer des Kantons; Ausbau des Monitorings der unterirdischen Gewässer (Quantität und Qualität) und Nutzung bereits erfasster Daten; Aktualisierung und Verbesserung der online-Entscheidungshilfe. | Ausbau des Monitorings der unterirdischen Gewässer (Quantität und Qualität) und Nutzung bereits erfasster Daten; Diese Massnahme wird zusammen mit Massnahme W.1.5 behandelt. | - | - | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Eine hydrogeologische Studie wurde in Auftrag gegeben, um die vorhandenen Daten zusammenzufassen und etwa 20 Fassungen/Grundwasserleiter auszuwählen, die für die klimatischen und hydrogeologischen Situationen des Kantons repräsentativ sind. Ziel ist es, die potenziellen quantitativen und qualitativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Grundwasserressourcen gemäss den im Bericht Hydro-CH2018 modellierten Szenarien zu bewerten, die am stärksten gefährdeten Grundwasserleiter und Fassungen zu identifizieren und so Vorschläge für Anpassungsmassnahmen zu erarbeiten. • Ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Ostschweiz, des Instituts für Umwelt und Natürliche Ressourcen (ZHAW) und der Hochschule für Technik und Architektur Freiburg (HTA-FR) über die Filtereffizienz für Material in der Grube wird unterstützt. Ziel des Projekts ist es, den Einfluss von Baumwurzeln und Strukturbildung auf den bevorzugten Wasserfluss in Böden zu untersuchen. Damit soll das Potenzial von Bäumen in Bezug auf Hitzereduktion, Verbesserung der Lebensqualität und Biodiversität ausgeschöpft werden. Gleichzeitig führt das hohe Verkehrsaufkommen in einigen Gebieten zu einer Verschmutzung des abfliessenden Wassers und damit zu Problemen beim Gewässerschutz. Das Vorhandensein von Bäumen in Bereichen, in denen verschmutztes Strassenabwasser versickert, führt zu Diskussionen, da vermutet wird, dass die Wurzeln der Bäume bevorzugte Abflusswege für das versickerte Wasser schaffen. Dadurch begünstigt das Wasser den Transport nicht nur von gelösten Stoffen, sondern auch von Partikeln. Es wird eine Bewertung der Relevanz des präferenziellen Transports für den Grundwasserschutz formuliert, zusammen mit Empfehlungen für die praktische Anwendung. | Abschluss der ersten Phase und Auswahl von Standorten, die für die hydrogeologischen und klimatischen Bedingungen des Kantons repräsentativ sind, um eine quantitative Überwachung der Qualität und Quantität des Grundwassers durchzuführen. | Geplant sind: • die Ausstattung von 6 Piezometern mit automatischen Messsonden für Pegel, Temperatur und elektrische Leitfähigkeit; • die Kontaktaufnahme mit den Betreiberinnen und Betreibern der ausgewählten Wasserfassungen (Quellen und Brunnen), damit diese eine Überwachung ihrer Ressource einrichten (oder die bestehende Überwachung ergänzen) und eine Fernübertragung der Daten auf ein Webportal, das deren Zentralisierung ermöglicht; • die Berechnung von Klima- und Vulnerabilitätsindizes für eine Auswahl von Wasserfassungen, für die ausreichend lange und vollständige Datenreihen vorliegen. | - |
| W.1.4 | Überwachung der Klimaparameter der Oberflächengewässer | 100% | 45% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2026 | Gijs Plomp | Die Überwachung der durch das Klima beeinflussten Parameter der Oberflächengewässer (Temperatur, Sauerstoffgehalt usw.) wird ausgebaut. | Die Überwachung der durch das Klima beeinflussten Parameter der oberirdischen Gewässer (Temperatur, Konzentration usw.) wird ausgebaut. | - | - | Durch die Umsetzung der Massnahme wurde das kantonale Monitoring der oberirdischen Gewässer gestärkt, um das Beobachtungsnetz zu optimieren. Dadurch konnte ab 2023 die Häufigkeit der Probenentnahme erhöht werden. | Die Umsetzung 2024 ermöglichte die Unterstützung der kantonalen Überwachung der Oberflächengewässer. | Die Umsetzung 2025 sieht den Start des Projekts zur Überwachung der Temperatur des Murtensees und die Fortsetzung der kantonalen Überwachung der Oberflächengewässer vor. | - |
| W.1.5 | Überwachung der Klimaparameter der unterirdischen Gewässer | 0% | 20% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2023-2026 | Gijs Plomp | Die Überwachung der durch das Klima beeinflussten Parameter der unterirdischen Gewässer (Temperatur, Konzentration usw.) wird ausgebaut. | Diese Massnahme wird zusammen mit Massnahme W.1.3 behandelt, mit dem Ziel, das Monitoring der unterirdischen Gewässer (Quantität und Qualität) auszubauen und die vorhandenen Daten zu nutzen. | - | - | Diese Massnahme wird im Rahmen der Massnahme W.1.3 umgesetzt. | Diese Massnahme wird im Rahmen der Massnahme W.1.3 umgesetzt. | Diese Massnahme wird unverändert im Rahmen der Massnahme W.1.3 umgesetzt. | - |
| W.1.6 | Konzept für die Wasserbewirtschaftung im Kanton Freiburg | 5% | 15% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2026 | Gijs Plomp | Damit künftige Entwicklungen der Wassernutzung besser eingeschätzt und mögliche Konflikte optimal vorweggenommen werden können, wird die Entwicklung des Wasserbedarfs für unterschiedliche Nutzungen analysiert. Diese Analyse umfasst die gesamte Bandbreite der Wassernutzung: Landwirtschaft, Grund- und Trinkwasserressourcen, Wasserkraft, Industrie, Freizeit, Fischerei, Tourismus usw. Aufgrund ihrer Wichtigkeit für die Trinkwasserversorgung wird den unterirdischen Wasservorkommen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W.1.6 ist es, die Gewässerbewirtschaftung an den aktuellen und den erwarteten Klimawandel anzupassen. | - | Es wird ein Pflichtenheft «Wasser» für die Entwicklung neuer nachhaltiger Quartiere erstellt. Ziel ist es, die Planung neuer Quartiere durch ein Konzept für die Wasserbewirtschaftung zu erleichtern, das die Nutzung von Trinkwasserressourcen verringert, um so allfälligen Konflikten vorzubeugen. | Der Auftrag für ein Konzept zur Wasserbewirtschaftung in den nachhaltigen Quartieren wird vom VSA unter Einbezug weiterer Kantone (GE) übernommen. | Veröffentlichung der Checkliste für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung bei der Planung neuer Quartiere. Zu diesem Thema wurde ein Webinar durchgeführt. Für das Konzept der Wasserbewirtschaftung wurden Arbeiten aufgenommen, um einen Überblick über die Wassernutzungen zu erhalten, diese Nutzungen nach ihrer Bedeutung und ihrem Wassereinsparpotenzial zu priorisieren und potenzielle Konflikte zwischen diesen Wassernutzungen zu klären, da diese mit dem Klimawandel (insbesondere in Trockenperioden) zunehmen könnten. | Erstellung einer Übersicht über die Wassernutzung, Priorisierung dieser Nutzungen nach ihrer Bedeutung und ihrem Wassereinsparpotenzial, Identifizierung potenzieller Konflikte. | Veröffentlichung einer Broschüre für die Planung von nachhaltigen Quartieren im Hinblick auf ein nachhaltiges Wassermanagement. Die Broschüre wird eine Checkliste, konkrete Beispiele sowie Empfehlungen für die Gemeinden (OP) enthalten. https://www.fr.ch/de/rimu/afu/news/checkliste-fuer-eine-nachhaltige-wasserbewirtschaftung-in-quartieren |
| W.1.7 | Durchführung von Sensibilisierungsaktionen für eine sparsame Wasserverwendung | 10% | 5% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Noch nicht definiert | Zur Sensibilisierung der Verbrauchenden für eine sparsame Wassernutzung wird eine Informationskampagne durchgeführt, die an das jeweilige Zielpublikum angepasst ist (Privatpersonen, Industrie, Landwirtschaft, Kinder und Jugendliche). Dabei wird auf eine Verwendung von alternativen Wasserquellen hingewiesen (Regenwasser usw.). Der Staat hat sich vorgenommen, hierbei als Beispiel zu wirken, und verlangt dasselbe von seinen Beauftragten. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W.1.7 besteht darin, einen verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit der Ressource Wasser bei allen Akteuren auf dem Kantonsgebiet zu fördern. | - | - | - | - | Die Umsetzung der Massnahme wird mit der Massnahme W.1.6 kombiniert; Wassereinsparungen erfordern Kenntnisse über den Wasserverbrauch, und das Wasserbewirtschaftungskonzept erfordert einen Überblick über mögliche Wassereinsparungen. | - |
| W.2.1 | Unterstützung der Massnahmen, die die Sicherheit der Trinkwasserversorgung auf den Alpen gewährleisten | 0% | 10% | Gemeinden, Bevölkerung | 400 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung für bauliche Massnahmen zur Begrenzung des Risikos von Wassermangel auf den Alpen, wobei darauf zu achten ist, dass keine neuen, noch naturbelassenen und für die Biodiversität wichtigen Quellen angezapft werden. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W.2.1 ist es, die Wasserversorgung von Alpen zu verbessern, damit das Vieh in der Höhe bleiben und der Einsatz von Hubschraubern zur Wasserversorgung vermieden werden kann (anders als in den Jahren 2003, 2015, 2018 und 2022). | - | Mit der Umsetzung der Massnahme konnte der Freiburgische Bauernverband (FBV) beauftragt werden, eine Bestandsaufnahme der bestehenden Infrastrukturen zu erstellen und den Wasserbedarf auf den Alpen zu analysieren. Die Studie begann mit einer Umfrage unter den Älplerinnen und Älplern im Kanton. | Der Auftrag des Freiburgischen Bauernverbands (AGRI Freiburg) lief bis 2023. Die Ergebnisse wurden in einem Bericht dargelegt werden, in dem die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Wasserversorgung auf den Freiburger Alpen dargestellt werden. | Die Umsetzung der Massnahme ermöglichte die Ausarbeitung eines einfachen und effizienten Subventionsverfahrens zur Unterstützung von Projekten zur Wasserversorgung der Alpen. Ausserdem konnten die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt und die Verordnung über die Beiträge für Massnahmen des kantonalen Klimaplans in der Landwirtschaft ausgearbeitet werden, damit die Subventionen an Landwirtinnen und ‑wirte oder Alpenbesitzerinnen und ‑besitzer ausgezahlt werden können. | Für die weitere Umsetzung sind das Inkrafttreten der Verordnung, eine Kommunikationskampagne und die Gewährung von Subventionen für kleine konkrete Projekte zur Verbesserung der Wasserversorgung der Alpen vorgesehen. | • Bericht «Sondage sur l'approvisionnement en eau des alpages fribourgeois» (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-09/rapport-w21-2023-avec%20compression.pdf • https://grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/klimaplan-landwirtschaft/massnahmen |
| W.4.1 | Einführung einer angemessenen Governance, damit Bewässerungsprojekte einfacher gestaltet und der Gewässerschutz mit der Landwirtschaft in Einklang gebracht werden kann | 195% | 100% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 150 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2024 | Melinda Zufferey-Merminod | Einführung einer angemessenen Governance, damit Bewässerungsprojekte einfacher gestaltet und der Gewässerschutz mit der Landwirtschaft in Einklang gebracht werden kann. | Die Massnahme W.4.1 hat das übergeordnete Ziel, eine geeignete juristische und institutionelle Struktur zu schaffen, damit bereits bestehende Bewässerungsprojekte unterstützt und die Schaffung neuer Bewässerungsprojekte gefördert werden können. Dadurch können insbesondere die notwendigen finanziellen Mittel mobilisiert werden, die zur Planung, Koordination und Durchführung dieser Projekte gleichzeitig mit anderen Massnahmen zur Anpassung in der Landwirtschaft notwendig sind. | - | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: Erarbeitung des Projektauftrags Bewässerungsstrategie und Bildung einer Arbeitsgruppe; Teilnahme am Projekt «Leitfaden Bewässerung» des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) zur Erstellung eines praktischen Leitfadens für die Ausarbeitung von Bewässerungsprojekten; Teilnahme am Projekt www.bewaesserungsnetz.ch in Partnerschaft mit der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) mit der Installation von 10 neuen Bodensonden für eine effiziente Bewässerung. | 2023 wurden die folgenden Massnahmen durchgeführt: •Bildung eines COPRO und COPIL; • Ausschreibung; •Auftragserteilung Bewässerungsstrategie; •Arbeitssitzungen zur Umsetzung der Bewässerungsstrategie des Kantons Freiburg; •Erarbeitung einer gemeinsamen Vision in einem partizipativen Prozess; •Verwirklichung von Etappe 1 des Auftrags durch das Büro. | 2024 wurden die folgenden Massnahmen durchgeführt: • Sitzungen des COPIL zur Überwachung der Strategie und zur bereichsübergreifenden Koordination der Projekte; • Beteiligung an der Gründung des Forums für eine nachhaltige Wasserbewirtschaftung in der Landwirtschaft; • Erstellung des technischen Berichts zur Bewässerungsstrategie unter Beteiligung des COPRO; • Pflichtenheft für einen Auftrag zur Ausarbeitung eines Strategiepapiers, das den technischen Bericht zusammenfasst und die Vision des Kantons sowie einen Aktionsplan vorstellt; • Vergabe des Auftrags an eine externe Fachperson. | Für die weitere Umsetzung sind folgende Massnahmen geplant: • Veröffentlichung der Bewässerungsstrategie des Kantons Freiburg • Antwort auf das Postulat zur Optimierung des regionalen Bewässerungsbedarfs und zum Ausbau des Bewässerungssystems im Kanton • Kommunikation | • Website Bewässerung: https://reseaudirrigation.ch/ |
| W.5.1 | Berücksichtigung der Klimaszenarien in Wasserbauprojekten und bei Unterhaltsarbeiten an Gewässern (Hochwasserschutz und Revitalisierung) | 70% | 75% | Staat FR, Gemeinden | 340 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2025 | Paul Rwakabayiza | Die Klimaszenarien werden in Wasserbauprojekten und bei Unterhaltsarbeiten an Gewässern dafür eingesetzt, dass diese Projekte so gut wie möglich an die sich ändernden klimatischen Bedingungen, die Entwicklung des Wasserhaushalts und die Risiken in Verbindung mit dem Klima angepasst sind. Ausarbeitung von Empfehlungen für die Projektträgerschaft zu den Bereichen Hochwasserschutz und Gewässerökologie (Gemeinden, Planungsbüros, Ingenieurinnen und Ingenieure für Gewässerverbauungen und Sachverständige in aquatischer Ökologie). | Das Hauptziel der Massnahme W.5.1 ist die Untersuchung und die Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer des Kantons. Gleichzeitig soll ein Verständnis dafür geschaffen werden, wie sich der Klimawandel auf den Wasserbau und den Gewässerunterhalt auswirkt, damit diese nachhaltig und langfristig gestaltet werden können. | Die Umsetzung der Massnahme W.5.1 ermöglichte folgende Ergebnisse: • Die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels auf die Schweizer und Freiburger Gewässer wurden erfasst und identifiziert (Entwicklung der Abflüsse, Wasserknappheit im Sommer, steigendes Gefahrenpotenzial, negative Auswirkungen der Wassertemperatur auf die aquatische Fauna). Davon ausgehend hat das AfU ein Pflichtenheft erstellt und ein in Hydrologie spezialisiertes Büro mit der Entwicklung und Übertragung der klimatischen und hydrologischen Szenarien auf regionaler Ebene beauftragt. •Aufbereitung von klimatischen und hydrologischen Daten für den Kanton Freiburg unter Berücksichtigung verschiedener Emissionsszenarien, detaillierter Oberflächenauflösungen des Kantons und seiner Einzugsgebiete sowie eines Zeithorizonts von 1981 bis 2099. Es wurden zahlreiche Simulationsketten erstellt und berechnet; • Des Weiteren wurde ein Workshop zum Austausch und zur gemeinsamen Arbeit mit den betroffenen kantonalen Dienststellen durchgeführt. Dieser diente der allgemeinen Information über die klimatischen und hydrologischen Szenarien, der Diskussion über die simulierten Szenarien sowie der Erfassung der Anliegen der anderen im Bereich der Gewässerbewirtschaftung tätigen Dienststellen, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels befassen. Darauf aufbauend werden klimatische und hydrologische Indikatoren definiert, mit denen die Auswirkungen auf die Gewässer aufgezeigt werden. Ziel ist, die Entwicklung der Gewässer im Kanton detailliert zu untersuchen. | Fortführung des 2021 begonnenen Auftrags. Ein Bericht wird im Sommer 2023 geliefert. | Mit dem Ziel, die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserbau und den Gewässerunterhalt zu bestimmen, wird ein Auftrag vergeben. Er zielt konkret darauf ab: •die Hochwasserabflüsse für eine kleine Zahl von typischen Einzugsgebieten im Detail zu bestimmen; •die Auswirkungen des Klimawandels auf den Abfluss unter Berücksichtigung der verschiedenen Prozesse zu untersuchen. | Der Auftrag für die Aktualisierung der Gefahrenkarten auf der Grundlage von klimatischen und hydrologischen Projektionen wird verlängert. | Es ist vorgesehen, neue Parameter im Zusammenhang mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf Naturgefahren in die Wasserbauprojekte und Projekte für den Gewässerunterhalt zu integrieren. | • Neue Schweizer Klimaszenarien CH2018: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/neue-schweizer-klimaszenarien-ch2018.html • Hydro-CH2018 Forschungsprojekte: https://www.nccs.admin.ch/nccs/de/home/das-nccs/themenschwerpunkte/hydro-ch2018/hydro-ch2018-forschungsprojekte.html |
| W.5.2 | Einführung eines Instruments zur Bewältigung von Konflikten in Zusammenhang mit der Wassernutzung | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 120 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Auf der Basis der Massnahme W.1.6 «Konzept für die Wasserbewirtschaftung im Kanton Freiburg» wird ein Instrument zur Konfliktlösung hinsichtlich der Wassernutzung ausgearbeitet. | - | - | - | - | - | ||
| W.5.3 | Unterstützung bei der Durchführung von Unterhaltsmassnahmen an Wasserläufen und Gewässern, die der Anpassung an den Klimawandel dienen | 10% | 5% | Gemeinden | 200 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Um den negativen Auswirkungen des Klimawandels auf die Gewässer und die Wasserfauna zu begegnen, werden Massnahmen ergriffen, die es erlauben, ihren Unterhalt anzupassen (adäquate Vegetation, Beschattung, Bekämpfung von Neophyten, Unterhalt der Gehölze, Synergien Biodiversitätsförderflächen (BFF), Monitoring der Veränderungen von Lebensräumen und Arten, Monitoring der Veränderungen der Temperaturparameter usw.). Die Massnahme will auch die Durchführung von Pilotprojekten unterstützen, die der Veröffentlichung von Empfehlungen für Gemeinden und Einzugsgebieten dient. | Aufgrund des Klimawandels muss der Gewässerunterhalt überdacht werden, um die Auswirkungen der veränderten chemisch-physikalischen Parameter in Fliessgewässern auf die Fauna und Flora zu vermindern. | - | - | - | Es wird ein Auftrag erteilt, um den Klimawandel in einen Unterhaltsplan zu integrieren. Dabei geht es insbesondere darum, die gefährdeten Abschnitte eines Fliessgewässers zu kartografieren und Massnahmen zu erarbeiten, um negative Auswirkungen des Klimawandels auf dieses Gewässer zu vermeiden. | Der 2024 gestartete Auftrag wird bis zum Sommer 2025 durchgeführt. Je nach Ergebnis könnte er auf weitere Gewässer des Kantons ausgeweitet werden. | - |
| W.5.4 | Optimierung des Monitorings von Trockenperioden hinsichtlich der Oberflächengewässer | 0% | 0% | Staat FR | 150 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Die Instrumente zur Bewirtschaftung der Oberflächengewässer werden optimiert, um die Auswirkungen auf die Lebensräume während Trockenperioden möglichst gering zu halten, eine effiziente Nutzung des Wasservorkommens zu garantieren (Optimierung des Abfluss-Monitorings, der Verfügbarkeit von Wasser in den Böden und des Wasserbedarfs) und die Bewässerungsstrategie auszurichten. | Der Klimawandel wirkt sich auf Niedrigwasserabflüsse aus, indem er die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Intensität von Trockenperioden erhöht. Daher muss die Überwachung der Fliessgewässer verbessert werden, um die Auswirkungen des Klimas auf die Umwelt während dieser Perioden zu verringern. | - | - | - | In einer ersten Phase zielt die Massnahme darauf ab, die personellen Ressourcen für die Überwachung der Auswirkungen von Trockenheit auf Oberflächengewässer zu unterstützen. | Es ist vorgesehen, unter dem Gesichtspunkt geografischer Informationssysteme zu arbeiten, um die Einschränkungen von Wasserentnahmen zu kartografieren. | - |
| W.5.5 | Umsetzung von Massnahmen zur Verringerung des Schadstoffeintrags in gefährdete Vorfluter bei Niedrigwasser | 60% | 75% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 370 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Gijs Plomp | Es werden Massnahmen umgesetzt mit dem Ziel, Schadstoffe bereits an deren Ursprung zu behandeln und zu verringern, um dadurch die Schadstoffmenge, die in den Vorflutern angelangt, zu senken und somit das Ausmass an Verschmutzungen, insbesondere bei Niedrigwasser (Trockenheit), zu begrenzen. In kritischen Fällen werden zum Schutz der Lebensräume die Einleitstellen verlegt. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W.5.5 ist es, den direkten und diffusen Eintrag von Schadstoffen in Vorfluter, die bei Niedrigwasser gefährdet sind, zu reduzieren und die Wasserqualität zu verbessern. Die Massnahme ist in 2 Schwerpunkte untergliedert, deren Ziel die Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer durch die Verringerung der anoxischen Phasen des Schiffenensees in den Sommermonaten und die Verbesserung der Qualität des Grundwassers durch die Verringerung des Pestizid- und Metabolitengehalts sind. A: Limnologische Studie über die Funktionsweise des Schiffenensees (Temperaturfluss, Nährstoffkreislauf, Aufenthaltszeit des Wassers, Biomasse usw.), die dem Verständnis der Ursachen des Sauerstoffrückgangs im See sowie der Ausarbeitung von Massnahmen (Belüftung des Wassers bei der Staumauer, neue Wasserfassung usw.) dient, durch welche die Fischsterblichkeit unterhalb der Staumauer reduziert werden kann. Diese Studie wird in 4 Etappen ablaufen (Datenerhebung und Vorschläge für weitere Analysen; Probenahmen und Analysen; Bestandsaufnahme und Identifizierung der wichtigsten Nährstoffquellen; Massnahmen). Die Ergebnisse sollten 2024 vorliegen. B: Die Ergebnisse werden im Laufe des Jahres erwartet.B: Durchführung von «Zu»-Projekten (Zuströmbereiche) bei Grundwasserfassungen für die Trinkwasserversorgung, um die Grundwasserqualität durch die Verringerung des Pestizid- und Metabolitengehalts zu verbessern; damit sind Projekte nach Artikel 62a GSchG oder 47 GSchV gemeint, die die Abgrenzung mehrerer Zuströmbereiche beinhalten und mindestens 10 bis 12 Jahre dauern. | Die Umsetzung der Massnahme führte in den beiden Schwerpunkten zu folgenden Ergebnissen: A: Phase 1 der limnologischen Untersuchung ergab u. a. einen hohen Nährstoffeintrag in den See. Um diesen Eintrag zu schätzen und zu modellieren, wurde ein Auftrag für alle vier Phasen vergeben. B: Hydrogeologische Studie des Zuströmbereichs Zu für eine strategische Grundwasserfassung im Kanton, damit ab 2022 bauliche und raumplanerische Massnahmen zum langfristigen Schutz des Grundwassers getroffen werden können. | Die Umsetzung der Massnahme führte in den beiden Schwerpunkten zu folgenden Ergebnissen: A: Die Phasen 1 und 2 sind abgeschlossen, mit Datenerhebungen, Vorschlägen für weitere Analysen (Wasser und Sedimente) und dem Start von Probenahmen (Beginn von Phase 3). Diskussion der Ergebnisse und Planung des weiteren Verlaufs der Studie (Phase 3). B: Fortsetzung der hydrogeologischen Studie (Zuströmbereich Zu) für eine Grundwasserentnahme für Trinkwasser im Kanton. | Die Umsetzung der Massnahme führte in den beiden Schwerpunkten zu folgenden Ergebnissen: A. Der laufende Auftrag für die limnologische Studie (stehende Gewässer) am Schiffenensee wird von VSA übernommen, wobei der Fokus auf der Modellierung und der Vereinfachung der Informationsaktualisierung liegt. Das BAFU sieht ein nationales Interesse in dieser Massnahme. B. Die Studie zur Abgrenzung des Zuströmbereichs der Wasserfassung Sodbach wird in Zusammenarbeit mit dem Wasserverband Sodbach gestartet. | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: • für den Schwerpunkt A die Finanzierung des Starts der automatischen Bewertung der Wasserqualität (durch das Büro HBT); • für den Schwerpunkt B die Einrichtung der Arbeitsgruppe für Studien zur Abgrenzung der Zuströmbereiche der Wasserfassungen. | Für die Fortsetzung der Massnahme ist Folgendes vorgesehen: • für den Schwerpunkt A die Erstellung einer Sensitivitätskarte für die Zulässigkeit von Einleitungen in Fliessgewässer; • für den Schwerpunkt B die Bewertung der Anfälligkeit repräsentativer Wasserfassungen des Kantons gegenüber dem Klimawandel. | • Aktionsplan zur Reduktion der Risiken von Pflanzenschutzmitteln: https://www.fr.ch/de/ilfd/news/aktionsplan-zur-reduktion-der-risiken-von-pflanzenschutzmitteln |
| W.5.6 | Umsetzung eines Monitorings von Trockenperioden für die unterirdischen Gewässer | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 200 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Es werden Instrumente entwickelt, die während Trockenperioden ein optimales Management der unterirdischen Wasserressourcen ermöglichen. Diese werden den betroffenen Akteuren zugänglich gemacht. Diese Instrumente basieren auf einem Monitoring der von der Trockenheit betroffenen Milieus, der Feuchtigkeit in den Böden und dem Wasserbedarf. | - | - | - | - | - | ||
| W.5.7 | Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserkraft | 25% | 5% | Staat FR, Energieerzeuger | 250 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Umsetzung von Studien, die es ermöglichen sollen, die Entwicklung der Wasserkraft bis 2050 entsprechend der voraussichtlichen Klimaentwicklung aufzuzeigen (Veränderungen des Wasserhaushalts und Produktionsrückgang sind vorhersehbar). Zudem werden die Konsequenzen, die sich aus den Klimaszenarien und Hydro-CH2018 ergeben (Zielarten, Temperaturen, Wasserhaushalt usw.) in die Sanierungsprojekte der Wasserkraft integriert. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme W 5.7 besteht darin, Studien zur Bewertung der Entwicklung der Wasserkraftproduktion bis 2050 durchzuführen und die potenziellen Produktionsverluste in Abhängigkeit von Klimaszenarien und den damit verbundenen Veränderungen der hydrologischen Verhältnisse aufzuzeigen. Diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Zielarten, Temperaturen und Abflussverhältnisse werden bei Projekten zur Sanierung der Wasserkraft berücksichtigt. | - | - | - | In einer ersten Phase zielt die Massnahme darauf ab, die personellen Ressourcen im Bereich der Wasserkraft und der Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserkraft zu unterstützen. | Es ist vorgesehen, Empfehlungen zur Sanierung der Wasserkraft unter Einbezug des Klimawandels zu erarbeiten. | - |
Energie und Gebäude
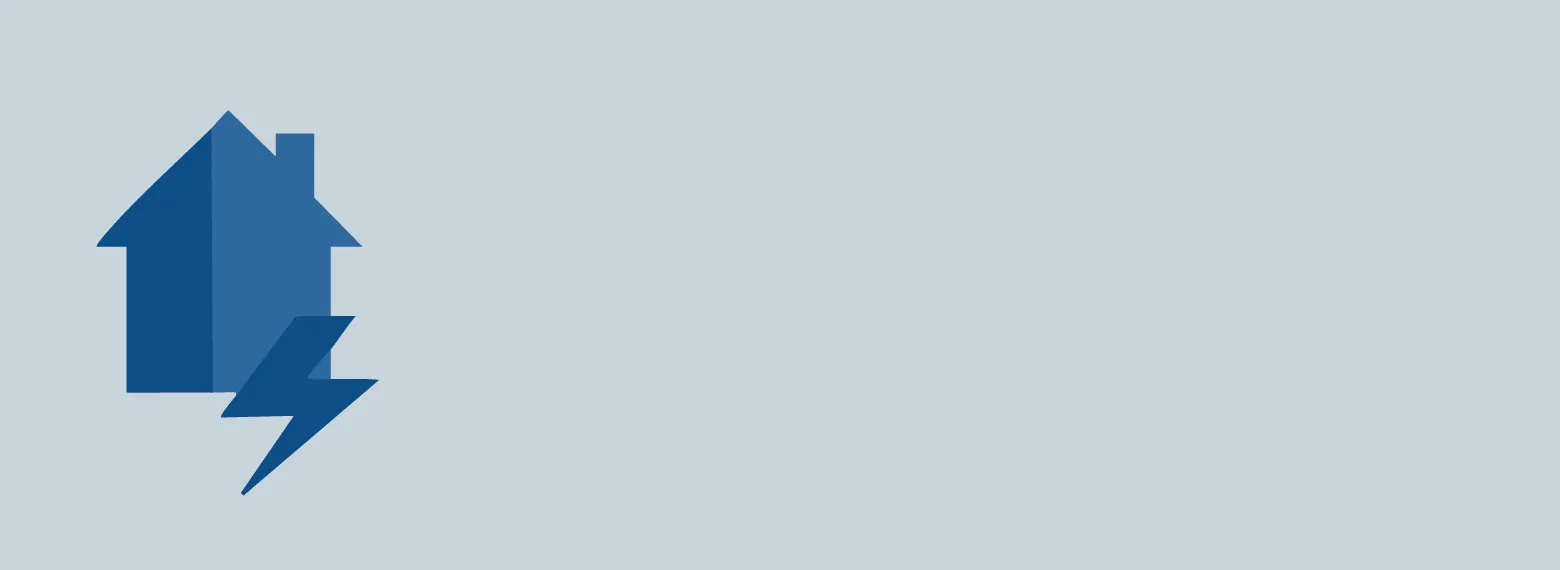
Das Hauptziel der Achse Energie und Gebäude liegt in der Verbesserung der Energieeffizienz und in der Reduktion des Verbrauchs fossiler Brennstoffe. Die spezifischen Ziele der Achse Energie und Gebäude sind:
- Verbessern der Energieeffizienz der Gebäude;
- Fördern einer energieeffizienten und kohlenstofffreien Energieversorgung;
- Steigern der Produktion lokaler, erneuerbarer Energien im Kanton Freiburg.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.1.1 | Studie über das Potenzial der Wasserkraft im Kanton Freiburg | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 130 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Durchführung einer Studie, die das Potenzial der Wasserkraftproduktion im Kanton Freiburg und der Integration von Klima- und Umweltschutzfragen analysiert. | - | - | - | - | - | - | |
| E.1.2 | Kommunikation über die rechtlichen Vorschriften betreffend Wärme- und Kälteerzeugung | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 150 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Dem Staat eine Datenbank der Eigentümerinnen und Eigentümer zur Verfügung stellen, um diese besser über die Entwicklung der Rechtsgrundlagen (insbesondere zur Wärme- und Kälteerzeugung) zu informieren und zu beraten. | - | - | - | - | - | - | |
| E.1.3 | Reduzierung der durch Elektrizität induzierten Emissionen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Bestimmung der Hebel und Massnahmen, mit welchen die Klimabelastung in Verbindung mit der Elektrizität reduziert werden können (Strombezug, ‑verbrauch und ‑produktion). | - | - | - | - | - | - | |
| E.1.4 | Analyse der Teilreserve des Kredits für Sanierungsmassnahmen | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 150 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Analyse der Möglichkeit, einen Teil der von der Bank bei einem Kredit gewährten Summe für Sanierungsmassnahmen zu reservieren. | - | - | - | - | - | - | |
| E.1.5 | Informationen über die Unterstützung bei der Installation von Photovoltaikanlagen | 100% | 50% | Gemeinden, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2024-2026 | Gijs Plomp | Initiierung einer Informationskampagne über die Lösungen, die den Eigentümerinnen und Eigentümern für die Installation von Photovoltaikanlagen geboten werden. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.1.5 besteht darin, die Einführung der Photovoltaik auf dem Kantonsgebiet zu beschleunigen, indem Eigentümerinnen und Eigentümer informiert werden und ihnen der Zugang zu Installationslösungen erleichtert wird. | - | - | - | Im Rahmen der Umsetzung dieser Massnahme wurde ein Erklärvideo über die Installation von Photovoltaikmodulen auf Dächern für Hausbesitzerinnen und ‑besitzer erstellt. Darüber hinaus wurden sechs Informationsveranstaltungen in den Gemeinden organisiert, an denen bis zu 74 Personen pro Veranstaltung teilnahmen. | Es ist geplant, die Umsetzung dieser Massnahme fortzusetzen. | Erklärvideo: https://vimeo.com/1069480161 |
| E.2.1 | Unterstützung der Gemeinden bei der Energieplanung | 10% | 5% | Gemeinden | 300 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2023-2026 | Gijs Plomp | Unterstützung bei der Umsetzung neuer von den Gemeinden oder Regionen getragenen Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der energetischen Treibhausgasemissionen. Diese Massnahme sieht insbesondere vor, die Umsetzung von Massnahmen zu subventionieren, die in den kommunalen Energieplänen enthalten sind, und konkrete Projekte im Zusammenhang mit der Energieplanung (z. B. Fernwärmeprojekte) zu unterstützen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.2.1 besteht darin, die Umsetzung neuer von den Gemeinden oder Regionen getragenen Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der energetischen Treibhausgasemissionen zu unterstützen. | - | - | Der Staatsrat hat die Verordnung über die Unterstützung von Massnahmen der Gemeinden im Energiebereich (SGF 815.13) verabschiedet, die eine vorübergehende Rechtsgrundlage für die Subventionierung von Gemeinden im Rahmen dieser Massnahme bietet, bevor das kantonale Klimareglement in Kraft tritt. Ein Flyer, der das Vorgehen und die Kriterien erläutert, wurde erstellt. | Anfang 2024 startete das Amt für Energie einen Aufruf zur Einreichung von Projekten. Sechs Gemeinden erhielten eine Zusage für eine Förderung ihres Projekts. Ein Projekt konnte 2024 abgeschlossen werden. | Die Massnahme ermöglicht es, die Unterstützung verschiedener kommunaler Projekte fortzusetzen. | • Artikel «Beiträge für Aktionen der Gemeinden im Energiebereich»: https://www.fr.ch/de/vwbd/afe/news/beitraege-fuer-aktionen-der-gemeinden-im-energiebereich • Verordnung: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/815.13 • Flyer: https://www.fr.ch/de/document/520396 |
| E.2.2 | Unterstützung der Forschung im Bereich der erneuerbaren Energien | 50% | 15% | Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 250 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2024-2026 | Marie Pichard | Zuordnung zusätzlicher finanzieller Mittel für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, die durch das kantonale Gesetz über die Wirtschaftsförderung unterstützt werden. | Unterstützung bei der Umsetzung neuer von den Gemeinden oder Regionen getragenen Massnahmen zur Reduktion des Energieverbrauchs und der energetischen Treibhausgasemissionen. | - | - | - | Die Massnahme ermöglichte einen Test der Pelletheizung auf dem Bauernhof Grangeneuve. Als potenzielle Alternative zur Ölheizung soll dieses System die Umgebungsluft erwärmen, die unter den Heuhaufen geblasen wird, um die Trocknungseffizienz zu verbessern. | Die Massnahme ermöglicht es, die Unterstützung des 2024 gestarteten Projekts fortzuführen. | |
| E.2.3 | Optimierung der Wärmeerzeugungssysteme | 35% | 20% | Gemeinden | 280 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2023-2026 | Gijs Plomp | Optimierung des Betriebs der gebäudetechnischen Anlagen (Heizung, Lüftung, Klimaanlage, usw.). Besondere Aufmerksamkeit wird der Energieeffizienz und der Innovation gewidmet. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.2.3 besteht darin, den Betrieb der technischen Anlagen in Gebäuden (Heizung, Lüftung, Klimatisierung usw.) zu optimieren. | - | - | Um die kantonale Unterstützung für Energieoptimierungen in den Gemeinden zu bewerben, werden mit der Energie-Stiftung Freiburg (ESF) Merkblätter mit guten Beispielen verfasst. Es wurde ein Flyer erstellt und im Oktober 2023 an alle Gemeinden verschickt. | Die Planung des Projekts Optimo zielt darauf ab, die Eigentümerschaft von Mehrfamilienhäusern dazu anzuregen, die Wärmeerzeugung zu optimieren, um den Energieverbrauch zu senken. Eine Verordnung über einen Förderbeitrag zugunsten von energetischen Optimierungsmassnahmen ist im Mai 2025 in Kraft getreten (SGF 770.12). | Für die weitere Umsetzung ist geplant, das Programm zu starten und mit den Schulungen für die Zertifizierung von Unternehmen zu beginnen. | • https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/energie/foerderbeitraege-fuer-die-energetische-optimierung-von-gebaeuden-mit-fuenf-oder-mehr-wohnungen • https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/770.12 |
| E.2.4 | Förderung der Begrünung von Dächern und Fassaden | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Förderung der Begrünung von Dächern und Fassaden von Gebäuden bei neuen Projekten oder Sanierungen im Hinblick auf eine bessere Wärmedämmung. Diese Massnahme ist auch eine Anpassungsmassnahme, die darauf abzielt, Hitzeinseln zu beschränken und die Wasserrückhaltung zu fördern. | - | - | - | - | - | - | |
| E.2.5 | Unterstützung des Ansatzes von bluefactory zu einem vorbildlichen Quartier mit dem Ziel der CO₂-Neutralität | 90% | 75% | Staat FR, Vereinigungen | 280 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2022-2026 | Marie Pichard | Unterstützung der Einführung eines beispielhaften Modells für zukünftige Quartiere unter besonderer Berücksichtigung der mit dem Bau verbundenen grauen Energie, der emissionsarmen Mobilität und der Planungsinstrumente. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.2.5 wird insbesondere erreicht durch: •die Einführung einer Methodik, die eine kohärente und ganzheitliche Planung eines Quartiers gewährleistet; •die Entwicklung eines Instrumentariums, das eine CO₂-Planung für jedes Quartier und jede Siedlungsentwicklung bis hin zur Umsetzung und zum Monitoring ermöglicht, einschliesslich einer Visualisierung der Ausführung (graue Energie und Mobilität) und einer Überwachung von Indikatoren; •die Planung der CO₂-Überwachung (parallel zur finanziellen Überwachung) in den Projektphasen (z. B. keine Teilnahme mehr an einem COPIL, ohne sich über die CO₂-Entwicklung zu informieren); •die Entwicklung eines Konzepts für einen dynamischen Mobilitätsplan, der die möglichen Entwicklungen des Quartiers innerhalb und ausserhalb des Quartiers einbezieht. | - | Die Massnahme E.2.5 führte zu folgenden Ergebnissen: • Nutzung von SetUp Pro zur Festlegung eines Voranschlags entsprechend der provisorischen Planung; • Festlegung der Schlüsseletappen des Bauverfahrens für die Gebäude B und Smart Living Lab; • Erstellung eines Pflichtenhefts für die Auftragnehmer. Das Unternehmen Climate Services hat die Entwicklung der CO₂-Emissionen des bluefactory-Standorts (graue Energie, Mobilität und Betriebsenergie) geschätzt und die zukünftigen Emissionen auf der Grundlage der getroffenen Entscheidungen bestimmt. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Entwicklung eines Instruments zur Bestimmung von tCO₂/m² in Abhängigkeit vom geplanten Baujahr – Anwendung auf zukünftige Gebäude und Anpassung an normative Entwicklungen; • Tool zur Bewertung der Kohlenstoffauswirkungen in Abhängigkeit von der Wahl der wichtigsten Bauelemente. Anwendung auf zukünftige Gebäude. Bewertung von Varianten und Vergleich mit dem CO₂-Budget; • Tool für die Planung von Massnahmen und die Bestimmung der Auswirkungen auf die CO₂-Bilanz – Definition möglicher Massnahmen und deren Auswirkungen auf die Entwicklung der Bilanz. | Im Jahr 2024 wurden folgende Ergebnisse erzielt: • Bereitstellung von Tools zur Berechnung des CO₂-Fussabdrucks von Gebäuden, Validierung von Simplibat in internen Projekten, was zu einer Verbesserung des Tools führte. • Im Hinblick auf die Quantifizierung der tatsächlichen Emissionen des Projekts für die Aussenraumgestaltung wurde eine allgemeine Methode für die Baustellen entwickelt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf eine für alle Beteiligten verständliche Nomenklatur gelegt. Das Ergebnis war eine Strukturierung in fünf Kategorien von CO₂-Emissionsquellen einer Baustelle, die sowohl punktuelle Emissionen (Lieferungen, Baustellenaktivitäten mit Maschinen, Logistik und Abfälle) als auch zeitlich gestaffelte Emissionen (Landschaftsgestaltung, Betrieb und Unterhalt) umfasste. • Mithilfe des Tools ProMove wurde eine Analyse des Mobilitätspotenzials des Standorts bluefactory durch eine Bestandsaufnahme der bestehenden Lösungen hinsichtlich der Erreichbarkeit des Standorts ergänzt. Anschliessend wurden Massnahmen zur Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel umgesetzt – etwa Vorzugstarife für Mitarbeitende von Unternehmen am Standort, in Zusammenarbeit mit FriMobil und der Agglomeration Freiburg. Ausserdem wurde die Signalisierung am Standort verbessert und eine Parkplatzregelung mit den Prioritäten für den Zugang eingeführt. Abschliessend erfolgte eine Bewertung des Mobilitätsplans im Hinblick auf die E'move-Zertifizierung. | Für die weitere Umsetzung muss das Projektteam die Entwicklung der Tools zur Berechnung des CO₂-Fussabdrucks sowie von ProMove abschliessen. | • Bericht bluefactory 2023 (nur auf Französich): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/Rapport%20mandats%20E.2.5%20-%20Bluefactory%202023.pdf • Bericht bluefactory 2024 (nur auf Französich): https://www.fr.ch/sites/default/files/2025-10/rapport-d-activite-mandat-bluefactory-2024.pdf |
| E.3.1 | Energetische Sanierung des staatlichen Immobilienbestands | 0% | 50% | Staat FR | 150 000 CHF | Hochbauamt (HBA) | Im Gang | 2023-2025 | Marie Pichard | Unterstützung der energetischen Sanierung des Immobilienbestands des Staats bei Renovierungen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.3.1 ist die Bereitstellung einer finanziellen Unterstützung für bestimmte Projekte zur Gebäudesanierung. | - | - | Im Rahmen der Umsetzung dieser Massnahme wurden die Leuchten im Gebäude Arsenaux 17 (Bezirksgericht Sense) ausgetauscht. | Diese Massnahme wurde 2024 ausgesetzt. | In den folgenden Jahren werden Sanierungsprojekte unterstützt; die Identifizierung dieser Projekte ist noch im Gang. | - |
| E.3.2 | Begrenzung der Heiztemperatur in Staatsgebäuden | 0% | 35% | Staat FR | 40 000 CHF | Hochbauamt (HBA) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Begrenzung der Heiztemperatur in Staatsgebäuden im Winter | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.3.2 liegt in der Erstellung einer Bestandsaufnahme der Heizpraktiken in den Staatsgebäuden sowie einer Liste der Gebäude, die betreffend Heiztemperatur am problematischsten sind. Auf dieser Basis aufbauend setzt das Projekt in den ausgewählten Gebäuden technische Verbesserungen um. Des Weiteren sieht die Massnahme E.3.2 vor, das Verhalten der Benutzerinnen und Benutzer der Gebäude anhand von Sensibilisierungsmassnahmen und anderen Mitteln (Charta, Dekret, Merkblatt usw.) zu lenken. | Die Massnahme E.3.2 führte zu folgenden Ergebnissen: • Bestandsaufnahme der Heizpraktiken in den Staatsgebäuden; • Erstellung einer Liste der Gebäude, die in Bezug auf die Heiztemperatur am problematischsten sind; • Veröffentlichung von Empfehlungen in Form eines Flyers, mit dem die Hauswartinnen und Hauswarte sowie die Baufachleute zur Senkung der Heiztemperatur in den Staatsgebäuden ermutigt werden; • Lancierung einer digitalen Kommunikationskampagne (News auf der Website fr.ch, soziale Netzwerke: Facebook-Seite des Amts für Umwelt, LinkedIn-Seite des Staats Freiburg, Instagram-Account @monplanclimat_meinklimaplan, Internetplattform meinklimaplan.fr.ch), um die Benutzerinnen und Benutzer für die Thematik der Begrenzung der Heiztemperatur in Staatsgebäuden zu sensibilisieren. | Diese Massnahme wurde 2022 nicht priorisiert, weshalb in diesem Jahr noch nichts unternommen wurde. | Diese Massnahme wurde 2023 nicht priorisiert, weshalb in diesem Jahr noch nichts unternommen wurde. | Diese Massnahme wurde 2024 ausgesetzt. | Weitere Interventionen erfolgen in den Gebäuden, die auf der Liste verzeichnet sind. | • Sensibilisierungskampagne «Eine Schicht mehr»: https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/klima/news/sensibilisierungskampagne-eine-schicht-mehr |
| E.4.1 | Erhöhung der Anzahl Unternehmen, die vom kantonalen Energiegesetz betroffenen sind | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 50 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Gijs Plomp | Unternehmen, die mehr als 3 GWh Wärme und/oder 0,3 GWh Strom pro Jahr verbrauchen dem eidgenössischen Energiegesetz unterstellen (Ausweitung der durch die heutigen Kriterien von 5 GWh bzw. 0,5 GWh betroffenen Unternehmen). | - | - | - | - | - | - | |
| E.4.2 | Verpflichtung zur Anzeige der GEAK-Etikette auf Immobilien | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 50 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Einführung einer Pflicht, die GEAK-Etikette in jeder Anzeige für den Verkauf oder die Vermietung einer Immobilie anzuzeigen. Einführung eines interaktiven kartographischen Registers der GEAK-Etiketten aller Immobilien im Kanton. | - | - | - | - | - | - | |
| E.5.1 | Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Kläranlagen | 0% | 55% | Gemeinden | 220 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2025 | Gijs Plomp | Reduzierung der Treibhausgasemissionen von Kläranlagen durch eine Optimierung der Produktion erneuerbarer Energie (Biogas, Abwärmenutzung, Mini-Hydraulik, Optimierung der Wasserzuflüsse, usw.). | Damit die Massnahmen zur Verminderung der THG-Emissionen rasch umgesetzt werden können, strebt die Massnahme E.5.1 als Hauptziel die Ausarbeitung eines Pflichtenheftes an, das bei einer ARA eine Testphase durchlaufen wird. Gleichzeitig wird ein Pflichtenheft für regionale ARA entwickelt, um deren Energieverbrauch (ARA + Pumpwerke + Kanalisationsnetz) zu begrenzen. Die Massnahme E.5.1 bezweckt zudem, auf der Grundlage der Erneuerung der ARA des Kantons, das Potenzial zur Emissionsreduktion der ARA zu identifizieren und deren Erneuerung auf der Grundlage der besten Varianten zu planen, durch welche die Optimierung des Energieverbrauchs, die vollständige und effiziente Nutzung von Biogas, die Nutzung der Abwärme von Abwasser sowie die Installation von Photovoltaikanlagen gefördert werden. | Die Massnahme E.5.1 führte zu folgenden Ergebnissen: • Erstellung eines Katalogs möglicher Massnahmen unter Identifizierung von sofort umsetzbaren Optimierungsmassnahmen und solchen, die weitere Untersuchungen erfordern; • Erstellung eines Pflichtenhefts, um ARA zu Emissionsreduktionen anzuleiten; • Erstellung eines einfach umzusetzenden Instruments zur Energieoptimierung in Form einer Entscheidungshilfe für die Inhaber von ARA. | Das für 2021 erarbeitete Instrument zur Energieoptimierung wurde bei einer ersten ARA getestet. Um die Reichweite der Massnahme zu erweitern, wurde auch ein neuer Auftrag vorbereitet. Dieser wird darauf abzielen, jeder ARA eine gezielte Beratung anzubieten, damit diese ihre direkten Treibhausgasemissionen reduzieren und auch ihren Energieverbrauch senken und optimieren. Anlässlich der jährlichen Informationsveranstaltung (InfoSTEP), die im Oktober in den Räumlichkeiten des AfU stattfand, wurden die ARA-Betreiber des Kantons zudem über den kantonalen Klimaplan und die laufenden Projekte im Bereich der Abwasserreinigung informiert. | In 17 der 26 ARA des Kantons fand eine technische Beratung statt. Die Beratung zeigte Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz, zur Erhöhung der Produktion von erneuerbaren Energien und zur Reduktion der Treibhausgasemissionen. Die Methanemissionen können zum Beispiel durch das Abdecken des Klärschlamms von vier Kläranlagen reduziert werden. Darüber hinaus wurde eine Kampagne zur Messung der Lachgasemissionen (N₂O) in der ARA der Stadt Freiburg gestartet. Ziel dieser Kampagne ist es, diese Emissionen zu quantifizieren und Wege zu ihrer Reduzierung vorzuschlagen. | Es wird eine Checkliste erstellt, um konkrete Ansätze zur Reduzierung des Energiebedarfs und der Treibhausgasemissionen von Kläranlagen zu geben. Diese Checkliste wird bei Bauprojekten in die Planung neuer Kläranlagen einbezogen. Bei der Messkampagne wurden erhebliche N₂O-Emissionen in der Kläranlage von Freiburg gemessen. Es werden Lösungen für die Abwasserbehandlung vorgeschlagen und mit den ARA diskutiert. | Die Massnahme wird verlängert. Die Checkliste wird veröffentlicht und an die ARA verschickt. Es ist vorgesehen, die N₂O-Emissionen in allen ARA des Kantons zu schätzen, Massnahmen zu ihrer Reduktion vorzuschlagen und die Kompensationsgewinne zu berechnen, die über die Stiftung KliK erzielt werden könnten. | • Artikel – Interaktive Beratung für die ARA: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/energie-und-gebaeude/e-5-1.html |
| E.5.2 | Beratung der Eigentümer bei Renovierungen und Sanierungen | 45% | 25% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 250 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2022-2025 | Gijs Plomp | Unterstützung von Massnahmen, die eine erste Beratung zur energetischen Sanierung ermöglichen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.5.2 ist es, die Rate der Gebäudeerneuerungen zu beschleunigen. | - | Das Kompetenzzentrum für Gebäudesanierung (KGS) ist seit 2022 ein unabhängiger Verein. Das Zentrum wird mit Unterstützung des Staats Freiburg für zwei Jahre verstetigt. | Die Massnahme konnte aus organisatorischen Gründen im Jahr 2023 nicht voranschreiten. | Das KGS wurde aufgelöst. Im Anschluss daran wurde eine Basisinfrastruktur eingerichtet, um Veranstaltungen zum Thema energetische Sanierung zu organisieren und eine ständige Energieberatungsstelle einzurichten. Dieses Pilotprojekt, das in der Stadt Freiburg durchgeführt wird, steht allen Freiburger Hausbesitzerinnen und ‑besitzern offen. | Für die weitere Umsetzung sind die Inbetriebnahme der Beratungsstelle und die Organisation von allgemeinen und individuellen Schulungen vorgesehen. | |
| E.6.1 | Pilotprojekt «Gebäude mit geringer klimatischer Auswirkung» | 110% | 105% | Staat FR, Vereinigungen | 175 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | Beendet | Marie Pichard | Unterstützung von Projekten des Smart Living Lab, die darauf abzielen, den CO₂-Fussabdruck von Gebäuden über ihren gesamten Lebenszyklus zu vermindern. Das Gebäude des Smart Living Lab, das auf dem Low-Carbon-Gelände der bluefactory errichtet wurde, wird als Fallstudie und als Vorzeigeprojekt dienen können. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme E.6.1 besteht darin, an der Erstellung des Fassaden-Prototyps für das zukünftige Gebäude des Smart Living Labs mitzuwirken. | - | Die Umsetzung dieser Massnahme wurde durch die Verzögerungen im Projekt des Gebäudes Smart Living Lab (SLL) in seiner Gesamtheit beeinträchtigt. Grund dafür war die Verteuerung der Baumaterialien aufgrund der geopolitischen Lage. Dennoch konnten die Forschungsarbeiten von der Gruppe Building2050 der EPFL durchgeführt werden; diese führten zu folgenden Ergebnissen: • Modellierung einer alternativen Nutzung des vom Totalunternehmer zu errichtenden Fassaden-Prototyps; • Konfiguration des Energiemodells anhand des digitalen Modells des Moduls, inkl. Studien zur Energieleistung nach Schweizer Normen, zum Tageslichtkomfort, zum thermischen Komfort im Sommer und zur Sonneneinstrahlung auf die Modulhülle; • Kalibrierung des Modells nach den genehmigten Bautechniken; ; • Erstellung der Dokumentation für die Bauprojektphase (SIA 3.32); • Machbarkeitsstudie und Definition der Arbeitsstrategie für Spezialteile, für die die PopUp-Werkstatt im Vergleich zum Markt eine effiziente Dienstleistung anbieten kann. Parallel zu den oben genannten Projekten wurde beschlossen, die Forschungsarbeiten des Teams von Professorin Joëlle Goyette (HTA-FR) zu unterstützen («Le radon dans le futur bâtiment du Smart Living Lab: Géothermie profonde, source alternative d'énergie et protection contre le radon: quelle compatibilité?»). | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Die Pläne des Fassadenprototyps wurden von BFF AG überarbeitet und freigegeben; • Der für Sommer 2023 geplante Baubeginn verzögerte sich. Was den zweiten Teil (Radon) betrifft: Da das SLL-Gebäude aus zwei unterschiedlichen und besonderen Bereichen besteht, wurden zwei Präventionsmethoden festgelegt: • eine Radondrainage unter der Bodenplatte des Ostteils des Gebäudes mittels Erzeugung eines Unterdrucks unter der Bodenplatte; • eine Radonsperre unter der westlichen Bodenplatte des Gebäudes, die auf Erdboden gebaut ist. Ein weites Feld von etwa 100 Radon-Sensoren wird in der VRO in verschiedenen Tiefen und Positionen unter und um das Gebäude sowie in der Gebäudehülle, die mit dem Gelände in Kontakt steht, installiert. Zu diesem Zweck wurden zwei unterschiedlichen Radon-Sonden (zylindrisch und flach) als Prototypen getestet und entwickelt. | Im Jahr 2024 konnten die Arbeiten am STEP-Pavillon (Sustainable Technologies & Experimentation Pavillion) vorangetrieben werden, insbesondere in Bezug auf das Elektroprojekt (FOXYM), die Metallkonstruktion, den Holzboden und die Elektroinstallation. Der Tätigkeitsbericht STEP-Pavillon 2024 (Smart Living Lab) enthält die Details dazu. | Diese Massnahme lief 2024 aus. | • Projektbeschreibung zum experimentellen Modul eines Fassadenprototyps für das Gebäude des Smart Living Lab: https://www.smartlivinglab.ch/de/projects/smart-living-lab-building-facade-prototype/ • Auf der CISBAT-Konferenz 2023 präsentiertes Poster: https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/resume-projet-autodigitrad.pdf •Tätigkeitsbericht STEP-Pavillon 2024 (Smart Living Lab) |
Mobilität

Das Hauptziel der Achse Mobilität besteht darin, den THG-Fussabdruck des Verkehrssektors unter Berücksichtigung der regionalen Situation (städtisch, ländlich) zu vermindern. Die spezifischen Ziele der Achse Mobilität sind:
- Verbessern und Fördern des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrsnetzes im Kanton Freiburg;
- Vermindern der durch individuellen Freizeitverkehr verursachten Treibhausgasemissionen;
- Reduzieren der mit der beruflichen Mobilität verbundenen Treibhausgasemissionen;
- Verringern des Mobilitätsbedarfs.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 23 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | Ausblick 24+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.1.1 | Sensibilisierung für die Verkehrsverlagerung | 65% | 80% | Bevölkerung | 150 000 CHF | Amt für Mobilität (MobA) | Im Gang | 2021-2024 | Paul Rwakabayiza | Unterstützung von Projekten zur Sensibilisierung für die Auswirkungen fossiler Verkehrsmittel (einschliesslich des Flugverkehrs) oder zur Förderung der sanften Mobilität und der Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme M.1.1 gilt während des gesamten Umsetzungszeitraums der Förderung der Verkehrsverlagerung im Kantonsgebiet, indem Aktionen unterstützt werden, die der Förderung der sanften Mobilität sowie des öffentlichen Verkehrs dienen und für die Auswirkungen des Individualverkehrs sensibilisieren. | Die Zusammenarbeit der drei Freiburger Sektionen von Pro Senectute (begleitete Veloausausflüge), dem TCS (E-Bike-Kurse) sowie von Pro Velo (Velofahrkurse für Eltern und Kinder) steht. Sie ermöglichte die Eröffnung neuer Kursorte und Angebot von Veloausflüge durch die drei Vereine sowie Einführung einer gewissen Anzahl kostenloser Kurse.
Es wurden auch Videoclips erstellt, um die Kurse und Spaziergänge im Jahr 2022 zu bewerben. |
In Fortsetzung des Angebots von 2021 wurden die Velokurse und ‑aktivitäten mit dem Ziel fortgesetzt, die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhöhen. Parallel dazu wurde eine weitere Aktion mit Schulen als Zielpublikum durchgeführt. Diese zielte darauf ab, einen schlüsselfertigen Katalog für Veloausflüge zu erstellen. Der Katalog ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Mobilität (MobA), dem Amt für Sport (SpA), den Ämtern für obligatorischen Unterricht (FOA und DOA), dem Freiburger Tourismusverband (FTV) sowie einem spezialisierten Büro. Er fasst die möglichen Velorouten und ihre Besonderheiten zusammen und wird im Frühjahr 2023 vorgestellt. | Der Katalog für Veloausflüge im Kanton Freiburg zuhanden der Lehrpersonen wurde im Frühjahr auf einer Medienkonferenz vorgestellt. Mit zahlreichen Tipps für die Organisation von Veloausflügen mit Schulklassen und 10 Routenvorschlägen ist der Katalog ein hervorragendes Instrument zur Förderung solcher Aktivitäten. Mit einem neuen Auftrag soll die Nutzung des Katalogs gefördert werden. Konkret bietet der in diesem Rahmen ergänzte Katalog Lehrpersonen und Schulen technische Checks und Vorbereitungskurse für Veloausflüge mit der Klasse. Er bietet auch mögliche Zusatzleistungen an, um die Velokultur in den Schulen zu stärken. Schliesslich bietet er Lehrpersonen, die mit ihrer Klasse einen Veloausflug organisieren möchten, persönliche Unterstützung und Begleitung an. | Der Katalog für Veloausflüge soll ausgebaut werden. Es werden auch Möglichkeiten erkundet, um seine Nutzung zu fördern und die flankierenden Massnahmen zu verstetigen. | • Förderung der sanften Mobilität mit Kursen und Velotouren, die vom Staat Freiburg unterstützt werden : https://www.fr.ch/de/rimu/afu/news/foerderung-der-sanften-mobilitaet-mit-kursen-und-velotouren-die-vom-staat-freiburg-unterstuetzt-werden
• PRO VELO Freiburg – PRO VELO Freiburg Verband für die Interessen der Velofahrenden (pro-velo-fr.ch) : https://www.pro-velo-fr.ch/de/ • Radfahren (prosenectute.ch) : https://fr.prosenectute.ch/de/aktivitaten/bewegung-und-sport/radfahren.html • E-bike Kurs - TCS Schweiz: https://www.tcs.ch/de/der-tcs/sektionen/freiburg/content/kurse-fahrtrainings/e-bike.php • Katalog für Veloausflüge im Kanton Freiburg : https://www.fr.ch/de/sport-und-freizeit/freizeitaktivitaeten/katalog-fuer-veloausfluege-im-kanton-freiburg |
| M.1.2 | Überlegungen zu einer Strategie für die Elektromobilität im Kanton | 100% | 60% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 80 000 CHF | Amt für Mobilität (MobA) | Im Gang | 2022-2024 | Paul Rwakabayiza | Einsetzung einer Arbeitsgruppe oder Durchführung einer Studie über die Zukunft der Elektromobilität im Kanton.
Es wird auch über eine mögliche vollständige Elektrifizierung des Fahrzeugparks des Staats und den Einsatz digitaler Werkzeuge zur Steigerung der Effizienz der Elektromobilität nachgedacht. |
Das übergeordnete Ziel der Massnahme M.1.2 besteht darin, eine koordinierte Entwicklung der Elektromobilität im Kanton Freiburg zu fördern (Analyse der aktuellen Situation, Festlegung von Zielen, Identifizierung der Mittel zur Erreichung der Ziele). | - | Um erste Überlegungen anzustellen, die die Grundlage für die Entwicklung einer Strategie für die Elektromobilität im Kanton bilden, wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Diese wird vom Amt für Mobilität (MobA) geleitet und umfasst Vertreterinnen und Vertreter des Generalsekretariats der Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (GS-RIMU), des Generalsekretariats der Sicherheits-, Justiz- und Sportdirektion (GS-SJSD), des Amts für Energie (AfE), des Tiefbauamts (TBA), der Kantonspolizei, des Amts für Strassenverkehr und Schifffahrt (ASS) sowie des Amts für Umwelt (AfU). In Absprache mit der eingesetzten Arbeitsgruppe wurde ein Auftrag an zwei spezialisierte Büros vergeben mit dem Ziel, eine Übersicht über die Situation der Elektromobilität im Kanton Freiburg (und in der Kantonsverwaltung) im Bereich des motorisierten Individualverkehrs und in geringerem Masse im Bereich der sanften Mobilität zu erstellen sowie die Massnahmen und die Umrisse einer Strategie oder eines Konzepts zu deren Entwicklung zu definieren. | Der im Jahr 2022 begonnene Auftrag wurde im Sommer 2023 beendet. Ein Bericht, der die Perspektiven für die Elektromobilität im Kanton Freiburg aufzeigt, wird dem Kanton vorgeschlagen. | Die wichtigsten Massnahmen, die in der Studie zur Elektromobilität im Kanton hervorgehoben wurden, sind Gegenstand einer Roadmap. Es werden Überlegungen angestellt, wie diese in bestehende Strategien und Pläne integriert werden können. | - |
| M.2.1 | Unterstützung der Anlagen der kombinierten Mobilität und deren Entwicklung | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 450 000 CHF | Amt für Mobilität (MobA) | Noch nicht begonnen | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Unterstützung des Sachplans Anlagen der kombinierten Mobilität und der Entwicklung von Projekten für solche Anlagen, welche die kleinstmögliche Fahrdistanz mit dem Auto oder dem Velo zu einem Bahnhof oder einer Bushaltestelle oder die Zurücklegung dieser Strecke mit dem Velo ermöglichen. | - | - | - | - | - | - |
| M.2.2 | Unterstützung der Mobilitätspläne | 100% | 0% | Staat FR, Gemeinden, Unternehmen | 200 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Im Gang | 2023-2026 | Paul Rwakabayiza | Die Gemeinden dazu ermutigen, die auf ihrem Gemeindegebiet ansässigen Unternehmen dazu anzuregen oder zu verpflichten, Mobilitätspläne zu erarbeiten, insbesondere durch eine Unterstützung des MobA bei der Einrichtung einer Webseite zur Förderung der Mobilitätspläne bei den Unternehmen und Gemeinden. Die Massnahme sieht bei Bedarf auch eine Unterstützung des Mobilitätplans des Staats vor. | Angesichts der gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf Mobilitätspläne besteht das allgemeine Ziel dieser Massnahme darin, die Einführung von Mobilitätsplänen für den Staat, die Gemeinden und die Unternehmen zu fördern. | - | - | Mit dem Inkrafttreten des neuen Mobilitätsgesetzes am 1. Januar 2023 sind Unternehmen und öffentliche Verwaltungen mit mehr als 50 Angestellten verpflichtet, einen Mobilitätsplan zu erstellen (Art. 49 Abs. 1 MobG).
Mit Blick auf die Kantonsverwaltung ermutigt der Staatsrat mit seiner Richtlinie über das Mobilitätsmanagement beim Staat seine Ämter, Mobilitätspläne zu erarbeiten, um Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu fördern. Bereits 2015 wurde eine Arbeitsgruppe Mobilitätspläne eingerichtet. Diese Gruppe hat unter anderem die Aufgabe, eine Planung für die Umsetzung von Mobilitätsplänen für den Staat zu erstellen, die Einführung von Mobilitätsplänen zu begleiten und den Massnahmenkatalog bewerten zu lassen. Es wurden Überlegungen angestellt, um die Massnahme M.2.2 durch diese Arbeitsgruppe behandeln zu lassen. Da die Arbeitsgruppe 2023 nicht mehr zusammenkommt, werden die Arbeiten hauptsächlich ab 2024 durchgeführt. |
Die Massnahme M.2.2, die in erster Linie auf Mobilitätspläne für den Staat ausgerichtet ist, zielt auch auf Gemeinden und Unternehmen ab.Im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Grundlagen werden Überlegungen zu diesen Zielgruppen angestellt. | - |
| M.2.3 | Förderung der Entwicklung von Verkehrsmitteln mit niedrigem Kohlenstoffverbrauch | 10% | 5% | Staat FR | 240 000 CHF | Wirtschaftsförderung Kanton Freiburg (WIF) | Im Gang | 2023-2025 | Paul Rwakabayiza | Unterstützung der Forschung nach alternativen Transportmodellen (Personen- und/oder Güterverkehr) mit niedrigen Treibhausgasemissionen oder die mit erneuerbaren Energien betrieben werden. | Ziel der Massnahme ist es, die Entwicklung von Technologien zu unterstützen, die die Emissionen des Verkehrssektors reduzieren. | - | - | Mit dem Ziel, die Forschung zu kohlenstofffreien Autoantrieben zu fördern, wird der Wettbewerb «Les 6h de Fribourg» unterstützt.Diese Veranstaltung wird von der Berufsfachschule Fribourg/Freiburg in Partnerschaft mit der HIKF organisiert. Ziel ist es, die neuen Energien durch eine Reihe von Vorträgen und eine Schweizer Auto-Challenge mit 1/10-Autos mit Brennstoffzellenantrieb (Wasserstoff) in den Vordergrund zu stellen. | Da der im Jahr 2023 unterstützte Wettbewerb jährlich stattfindet, könnte eine weitere Unterstützung erfolgen. Parallel dazu wird die Unterstützung weiterer Projekte geprüft. | - |
| M.2.4 | Unterstützung der Förderung des Fahrrads im Kanton | 100% | 20% | Bevölkerung | 700 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Im Gang | 2022-2026 | Paul Rwakabayiza | Unterstützung bei der Verbesserung der Bedingungen für Velofahrerinnen und ‑fahrer, insbesondere bei der Überarbeitung des Mobilitätsgesetzes und der Umsetzung des Sachplans. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme M.2.4 ist die Unterstützung von Aktionen und Projekten, die die Entwicklung des Veloverkehrs im Kanton fördern. | - | Im Hinblick auf eine Revision des Sachplans Velo, die mit dem neuen Bundesgesetz über Velowege und dem neuen Mobilitätsgesetz (MobG) in Einklang stehen soll, wurden erste Überlegungen angestellt.
Der Sachplan Velo, der auf der Grundlage des kantonalen Strassengesetzes erstellt wurde, muss aktualisiert werden, um die neuen Bestimmungen zu integrieren. |
Im Anschluss an die Überlegungen, die 2022 angestellt wurden, wurde ein Auftrag mit folgenden Zielen vergeben:
• Erstellung einer Diagnose des aktuellen Sachplans Velo unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Vorschriften; • Überarbeitung des Sachplans Velo auf der Grundlage der Diagnose. Im Rahmen dieser Massnahme wurde auch ein Auftrag für die Planung des kantonalen Mountainbike-Netzes vergeben. |
Die im Jahr 2023 lancierten Aufträge werden im Jahr 2024 weiterverfolgt. Auf dieser Grundlage werden die nächsten Arbeiten für die Umsetzung des Sachplans Velo geplant. | • Sachplan Velo: https://www.fr.ch/de/mobilitaet-und-verkehr/langsamverkehr/sachplan-velo |
| M.2.5 | Unterstützung der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs | 100% | 25% | Bevölkerung | 1 300 000 CHF | Amt für Mobilität (MobA) | Im Gang | 2023-2026 | Paul Rwakabayiza | Finanzielle Unterstützung zur Entwicklung des öffentlichen Verkehrsnetzes im Kanton. Die Massnahme sieht insbesondere die Unterstützung des Projekts zur Entwicklung der bestehenden Linien, interkantonale Linien inbegriffen, und zur Schaffung neuer Linien vor, insbesondere städtischer Linien in Estavayer, Murten und Romont. | Ziel dieser Massnahme ist es, einen finanziellen Beitrag zum Ausbau der öffentlichen Verkehrslinien im Kanton zu leisten und so die Verkehrsverlagerung auf den öffentlichen Verkehr zu fördern. | - | - | In Zusammenarbeit mit dem Amt für Mobilität unterstützt der kantonale Klimaplan den Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots zwischen dem Vivisbachbezirk und der Waadtländer Riviera. | Es werden neue Unterstützungen für die Entwicklung des öffentlichen Verkehrsangebots gewährt. | - |
| M.3.1 | Förderung der Reduktion der Flugreisen des Staatspersonals | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 30 000 CHF | Amt für Personal und Organisation (POA) | Noch nicht begonnen | 2024-2026 | Noch nicht definiert | Ermutigung des Staatspersonals, bei Geschäftsreisen ins Ausland die Bahn zu benutzen, mit einem Verbot von Flugreisen für Strecken unter 1500 km bzw. für Reisen, die mit Bahn oder Bus weniger als 7 Stunden dauern. Ferner müssen alle Flugreisen «kompensiert» werden. Auch wird den Mitarbeitern/-innen ein Online-Tool zur Verfügung gestellt, um sie bei der Abklärung der verschiedenen Verkehrsoptionen zu unterstützen. | - | - | - | - | - | - |
| M.3.2 | Behebung des Vorteils des Autos bei Reisen des Staatspersonals | 0% | 0% | Staat FR | 50 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Im Gang | 2021-2026 | Paul Rwakabayiza | Prüfung einer möglichen neuen Verordnung oder neuer Richtlinien (z. B. Subventionierung des GA, offeriertes Halbtax, Bereitstellung von Velos oder E-Bikes), um das Staatspersonal zur Nutzung der sanften Mobilität oder des öffentlichen Verkehrs zu motivieren. | Im Zusammenhang mit der Revision des Beschlusses über die Parkplätze des Staatspersonals ist das übergeordnete Ziel der Massnahme M.3.2 eine breit angelegte Förderung der sanften Mobilität bei Dienstfahrten (Velo, öffentlicher Verkehr und Gehen). | Beurteilung der Durchführbarkeit im Zusammenhang mit der Revision des Gesetzes und des Reglements über das Staatspersonal (StPG und StPR), die sanfte Mobilität umfassender zu fördern. | Identifizierung von Synergien mit der Strategie Nachhaltige Entwicklung des Staats Freiburg, insbesondere im Zusammenhang mit den Mobilitätsplänen und Vorbereitungsarbeiten für die Revision des Beschlusses über die Parkplätze des Staatspersonals. | Weil die Massnahme M.3.2 von der Massnahme M.2.2 abhängt, wurden Überlegungen unter dem Gesichtspunkt der Mobilitätspläne angestellt. So ist geplant, ein Mitglied der Sektion Klima in die Arbeitsgruppe Mobilitätspläne aufzunehmen. | Für die weitere Umsetzung müssen folgende Massnahmen getroffen werden:
• Diskussionen in der Arbeitsgruppe Mobilitätspläne; • Diskussion im Rahmen der Arbeitsgruppe über die Revision des Beschlusses über die Parkplätze des Staatspersonals und insbesondere über die Integration der Förderung der Fortbewegung mit sanfter Mobilität und öffentlichen Verkehrsmitteln; • Identifizierung mit der Arbeitsgruppe der Möglichkeiten für die Integration der Förderung der sanften Mobilität und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bei der Fortbewegung des Staatspersonals in allfällige neue Richtlinien oder Beschlüsse zum StPG. |
- |
| M.3.3 | Begrenzung der Pendelreisen des Staatspersonals und Förderung der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 50 000 CHF | Amt für Personal und Organisation (POA) | Noch nicht begonnen | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Begrenzung der Pendelreisen durch die Erhöhung des Telearbeit-Anteils, die Förderung von Co-Working-Räumen, die Anpassung der Arbeitszeiten der Staatsangestellten und die Arbeit an den Tarifen für Parkplätze. Die Massnahme zielt auch darauf ab, die Unternehmen zu ermutigen, dies ebenfalls zu tun. | - | - | - | - | - | - |
| M.4.1 | Besteuerung der stark emittierenden Fahrzeuge | 0% | 20% | Bevölkerung | 50 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Paul Rwakabayiza | Nach der Revision des Gesetzes über die Besteuerung der Motorfahrzeuge und Anhänger wurden Gespräche über die Besteuerung der leichten Fahrzeuge (<3,5 t) mit hohen Treibhausgasemissionen geführt. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme M.4.1 besteht darin, leichte Fahrzeuge nach einem stark progressiven Tarif zu besteuern, der sich nach der Motorleistung richtet. Eine Steuerreduktion wird nur Fahrzeugen mit Hybrid-, Gas-, Elektro- oder Wasserstoffantrieb und Fahrzeugen mit der Energieetikette A gewährt. | Das Jahr 2021 war geprägt von der Annahme der Revision des BMfzAG durch den Grossen Rat (Inkrafttreten am 01.01.2022), die Steuerreduktionen für Fahrzeuge mit Hybrid- und Gasantrieb (‑15 %), Elektro- und Wasserstoffantrieb (‑30 %) sowie mit der Energieetikette A (‑30 %) ermöglicht. sind kumulierbar (bis zu 60 %).
Der Bestand an Hybrid- und Elektrofahrzeugen stieg um 60 % und entspricht 6,3 % des gesamten Fahrzeugbestands. Am 30. September 2021 waren 12'161 Einheiten registriert, während der Bestand ein Jahr zuvor bei 7601 Einheiten lag. Parallel dazu wurden die von den Teilnehmern des Climathon Freiburg 2021 eingebrachten Überlegungen mit innovativen Lösungen für die Änderung des Mobilitätsverhaltens untersucht. Die Aussichten für die Integration des Projekts eines der Gewinnerteams in die Massnahme M.4.1 wurden bewertet. |
- | Bis 2023 werden für diese Massnahme keine Aktionen durchgeführt, abgesehen von der Überwachung der Entwicklung der Flotte leichter Fahrzeuge. | Beobachtung der Entwicklung des Bestands leichter Fahrzeuge; dies betrifft v. a. die Anzahl Fahrzeuge, die den Kriterien von Art. 11 BMfzAG entsprechen.
Da die Massnahme beendet ist, könnte das Budget für eine Massnahme im selben Sektor umgewidmet werden. |
• ASF 2021_021 - Gesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge und Anhänger (BMfzAG), vom 11.02.2021: https://bdlf.fr.ch/app/de/change_documents/3224 |
| M.4.2 | Begünstigung der Einrichtung von Ladestationen für Elektroautos | 100% | 45% | Staat FR, Bevölkerung | 120 000 CHF | Hochbauamt (HBA) | Im Gang | 2021-2025 | Paul Rwakabayiza | Förderung und Planung der Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf staatlichem, öffentlich zugänglichem Gelände. | Die Massnahme M.4.2 hat als übergeordnetes Ziel, die Einrichtung von Ladestationen für Elektroautos durch die Gewährung einer finanziellen Unterstützung zu fördern. | Die Umsetzung der Massnahme M.4.2 führte zu folgenden Ergebnissen:
• Bestimmung der verfügbaren Parkplätze für Besucherinnen, Besucher und Staatsangestellte (zwei Immobilienportfolios); • Planung der Einrichtung von vier Ladestationen für Elektroautos, zwei davon am Standort des Kollegiums des Südens und zwei am Standort des Gebäudes der Volkswirtschaftsdirektion in Freiburg. Beim zweiten Standort sind Leerrohre vorgesehen, damit in Zukunft auf einfache Weise weitere Ladestationen eingerichtet werden können. Die Arbeiten beginnen bei beiden Standorten im Februar oder März 2022. |
Installation der Ladestationen an den beiden ausgewählten Standorten im Jahr 2021. Für den Standort Freiburg (Boulevard de Pérolles 25) wurden zusätzliche Leerrohre vorgesehen, um die spätere Installation von vier weiteren Ladestationen zu erleichtern. | Da die Massnahme M.1.2 «Überlegungen zu einer Strategie für die Elektromobilität im Kanton» ebenfalls Gegenstand von Arbeiten zur Entwicklung der Elektromobilität innerhalb der Kantonsverwaltung ist, wird die Massnahme M.4.2 bis zum Vorliegen der Ergebnisse des Projekts ausgesetzt. | Für die weitere Umsetzung müssen folgende Massnahmen getroffen werden:
• Analyse neuer geeigneter (öffentlich zugänglicher) Standorte für die Einrichtung von Ladestationen in den anderen Immobilienportfolios des Staats; • Analyse der Nutzung der ersten vier, während der Pilotphase installierten Ladestationen, um sie zu optimieren (z. B. Verbesserung der Zugänglichkeit, der Kommunikation); • Identifizierung alternativer Finanzierungsmechanismen für die Einrichtung von Ladestationen in Ergänzung zum KKP. |
• Ladestationen für Elektrofahrzeuge: https://www.energieschweiz.ch/tools/ladeinfrastruktur-schweiz/?pk_vid=617d381193f27b771694768263b284c6 |
| M.4.3 | Begünstigung der Immatrikulation von Fahrzeugen, die ausschliesslich mit elektrischer Energie oder Wasserstoff angetrieben werden oder mit einem Hybridmotor ausgestattet sind. | 0% | 25% | Bevölkerung | 40 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Paul Rwakabayiza | Nach der Revision des Gesetzes über die Besteuerung der Motorfahrzeuge und Anhänger und für weitere Revisionen wurden Steuererleichterungen für die Besitzerinnen und Besitzer von Fahrzeugen, die mit elektrischer Energie oder Wasserstoff angetrieben werden oder mit einem Hybridmotor ausgestattet sind, besprochen. | Ziel der Massnahme M.4.3 ist es, die Zulassung von Fahrzeugen mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb durch Steuererleichterungen zu fördern. | Das Jahr 2021 war geprägt von der Annahme der Revision des BMfzAG durch den Grossen Rat (Inkrafttreten am 01.01.2022), die Steuerreduktionen für Fahrzeuge mit Hybrid- und Gasantrieb (‑15 %), Elektro- und Wasserstoffantrieb (-30%) sowie mit der Energieetikette A (‑30 %) ermöglicht. sind kumulierbar (bis zu 60 %). | - | Bis 2023 werden für diese Massnahme keine Aktionen durchgeführt, abgesehen von der Überwachung der Entwicklung der Flotte leichter Fahrzeuge. | Sollten neue Anpassungen des BMfzAG in Betracht gezogen werden, bestünde die Möglichkeit, eine Vertreterin oder einen Vertreter der Sektion Klima in die Arbeitsgruppe aufzunehmen.
Da die Massnahme beendet ist, könnte das Budget für eine Massnahme im selben Sektor umgewidmet werden. |
• ASF 2021_021 - Gesetz über die Besteuerung der Motorfahrzeuge und Anhänger (BMfzAG), vom 11.02.2021: https://bdlf.fr.ch/app/de/change_documents/3224 |
| M.5.1 | Festlegung von Zielen zur Reduzierung der Emissionen im Verkehrssektor | 100% | 0% | Staat FR | 60 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Im Gang | 2023-2026 | Paul Rwakabayiza | Festlegung von bezifferten Zielen (mit Beurteilungsindikatoren) mit Fristen zur Reduzierung der Treibhausgase im Verkehrssektor. Diese Ziele könnten in einer Richtplanung übernommen werden. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme T.1.1 besteht darin, die Instrumente bereitzustellen, die nötig sind, um das kantonale Klimaziel im Verkehrssektor zu erreichen. | - | - | Die Massnahme M.5.1 erfüllt das gleiche Ziel wie die Massnahme T.1.1, speziell für den Verkehrssektor. Sie wurde 2023 im Rahmen des Auftrags zur Massnahme T.1.1 behandelt. | Die Besonderheiten des Verkehrssektors im Hinblick auf die Klimaziele werden Gegenstand von Überlegungen und Arbeiten sein, um die vom Kanton eingeführten Massnahmen zu ergänzen und zu verfeinern. | - |
Raum und Gesellschaft

Das Hauptziel der Achse Raum und Gesellschaft liegt in der Verringerung der Anfälligkeit und der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit an den Klimawandel und die Naturgefahren des Raumes, der darin lebenden Bevölkerung sowie der darin ausgeführten Aktivitäten. Die spezifischen Ziele der Achse Raum und Gesellschaft sind:
- Integrieren der Problematiken starke Hitze und Oberflächenabfluss in die Strategien der Raumplanung, der Siedlungsgestaltung und der Infrastrukturen und Gebäude;
- Berücksichtigen des Frequenzanstiegs und der Intensität von Naturgefahren im Rahmen eines integrierten Risikomanagements;
- Erkennen, Verhindern und Kontrollieren der mit dem Klimawandel verbundenen Gesundheitsrisiken;
- Begleiten der am direktesten betroffenen Wirtschaftszweige bei ihrer Anpassung an den Klimawandel (insbesondere die Landwirtschaft und der Tourismus).
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.1.1 | Entwicklung eines Hitzemassnahmenplans für gefährdete Personen | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 160 000 CHF | Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Marie Pichard | Einrichtung automatischer Telefonbenachrichtigungen für Menschen, die durch Hitze gefährdet sind. | - | - | - | - | - | Ermittlung der Bedürfnisse und Möglichkeiten des Freiburger Gemeindeverbands hinsichtlich der Einrichtung automatischer Telefonalarme für hitzegefährdete Personen. | - | |
| S.1.2 | Durchführung von Sensibilisierungsaktionen zur Stärkung der Gesundheitskompetenzen der Bevölkerung im Hinblick auf die klimatischen Herausforderungen | 30% | 25% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 150 000 CHF | Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Die Bevölkerung, einschliesslich der Risikogruppen, wird über die klimatisch bedingten gesundheitlichen Risiken, die mit solchen meteorologischen Extremereignissen wie grosser Hitze, verbunden sind, informiert und sensibilisiert. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.1.2 ist die Information und Sensibilisierung der Bevölkerung – insbesondere der Risikogruppen – über die gesundheitlichen Risiken, die mit extremen Wetterphänomenen wie Hitzewellen verbunden sind. Die Gesundheitskompetenzen der Bevölkerung werden verstärkt und die Zielgruppen sind in der Lage, adäquate präventive Massnahmen zu ergreifen. | - | Im Jahr 2022 wurden die Arbeiten an dieser Massnahme in Angriff genommen. Dies geschah in mehreren Arbeits- und Austauschsitzungen, an denen das Amt für Gesundheit (GesA), das Amt für Umwelt (AfU) und das Kantonsarztamt (KAA) beteiligt waren, um die Richtung der Umsetzung zu definieren. Mit dem Beginn der Arbeiten sollte bestimmt werden, welche Sensibilisierungsmassnahmen möglich sind, für welche Bevölkerung, für welche Zielgruppe(n) und für welche klimatischen Herausforderungen. Nach einem Austausch zwischen den betroffenen Dienststellen wurde die Massnahme in zwei Teile aufgeteilt: • Der erste Teil bestand aus einem Auftrag, das das AfU an Biol Conseil SA erteilte, um eine Karte der Hitzeinseln von 18 Gemeinden zu erstellen, die als prioritär definiert wurden, und Zonen hervorheben, die bei sogenannten gefährdeten Bevölkerungsgruppen (ältere Menschen, Kinder usw.) zu Gesundheitsproblemen führen können. Diese Kartierungen ermöglichen die Sensibilisierung der Gemeinden für die klimatischen Herausforderungen auf ihrem Gebiet. • Für die Umsetzung des zweiten Teils der Massnahme hat das GesA Überlegungen zur Entwicklung eines Weiterbildungsangebots zu Fragen zu umweltbezogene Gesundheit und Klima/Gesundheit angestellt, das sich an Fachleute aus dem Gesundheits- und Sozialwesen richtet, die mit besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu tun haben. Zu diesem Zweck hat das GesA Kontakte und Überlegungen mit der Hochschule für Gesundheit aufgenommen, um zu prüfen, inwieweit die Entwicklung eines massgeschneiderten Weiterbildungsangebots für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (insbesondere Gesundheitsfachkräfte) zu Fragen zu umweltbezogene Gesundheit denkbar ist. | Im Jahr 2023 wurden verschiedene Kontakte geknüpft, um einerseits den Bedarf der Gesundheitsstrukturen an Schulungen zu den Themen Klima und Gesundheit auszuloten und andererseits abzuklären, ob bereits bestehende Projekte in Bezug auf die Thematik der Sonnenprävention verstärkt werden könnten. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Massnahme das Projekt zur Kartierung von Hitze- und Kühlinseln sowie zur Analyse der Vulnerabilitätszonen von 18 prioritären Gemeinden initiiert. | 2024 wurde im Rahmen der Massnahme das Projekt zur Kartierung von Hitze- und Kühlinseln sowie zur Analyse der Vulnerabilitätszonen von 18 prioritären Gemeinden fortgeführt. Darüber hinaus konnte im Rahmen der Massnahme die Erstellung eines Leitfadens zur Klangraumgestaltung unterstützt werden. | Für 2025 besteht das Ziel darin, weiterhin Sensibilisierungsmassnahmen zu unterstützen, die darauf abzielen, die Gesundheitskompetenzen der Bevölkerung im Hinblick auf die klimatischen Herausforderungen zu stärken. | • Kartierung der Hitzeinseln und Vulnerabilitätszonen – Lesehilfe: https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-06/kartierung-der-hitzeinseln-und-vulnerabilitatszonen--lesehilfe.pdf | |
| S.1.3 | Kartierung der Hitzeinseln in Siedlungsgebieten des Kantons und Vorschlag von Massnahmen zur Anpassung | 10% | 35% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 600 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Unterstützung bei der Realisierung von Karten zu Wärmeinseln in den wichtigsten Siedlungsgebieten des Kantons und Vorschlag für Massnahmen zur Anpassung. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.1.3 ist die Unterstützung der Gemeinden bei der Bewältigung der Problematik der städtischen Hitzeinseln durch die Erstellung von Kartierungen für die wichtigsten Siedlungsgebiete des Kantons sowie die Unterstützung von Massnahmen zur Verringerung Hitzeinseln und deren Folgen (Projekte zur Kühlung der Stadtzentren und Sensibilisierung der Bevölkerung für diese Thematik). | Massnahme S.1.3 führte zu folgenden Ergebnissen: • Unterstützung für den Bau des Pavillons DEMO-MI2, dessen Projekt unter dem Link am Ende der Seite beschrieben ist; • Organisation eines Klima-Lunches zum Thema Hitzeinseln im Mai 2021; • Erstellung und Verbreitung eines Erklärvideos für die Bevölkerung in Form eines Interviews mit den Verantwortlichen der Stadt Freiburg. | Arbeiten zur Erstellung einer Broschüre über städtische Hitzeinseln für die Gemeinden, um sie für die Thematik zu sensibilisieren und sie über die Aktionsmitteln zu informieren, die ihnen auf der rechtlicher Ebene (Gemeindebaureglement) sowie auf Ebene der Massnahmen zur Verringerung zur Verfügung stehen, wie auch über deren Auswirkungen. | Die Umsetzung führte zu folgenden Ergebnissen: •Veröffentlichung des Wegweisers zu städtischen Hitzeinseln für Gemeinden; •Start des Pilotprojekts in der OS Jolimont zur Anpassung des Schulhofs an den Klimawandel (Einführung eines partizipativen Prozesses, der Schüler und Lehrer einschliesst, Entwicklung von Modellen für provisorische Pavillons. | Das Pilotprojekt für Pavillons im Innenhof der OS Jolimont konnte mit der Installation von zwei modularen Strukturen abgeschlossen werden. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt für Geoinformation eine erste Situationsanalyse durchgeführt, um bioklimatische Daten auf Kantonsebene zu modellieren, ähnlich wie dies in den benachbarten Kantonen bereits geschehen ist. | Die Festlegung des Pflichtenhefts sowie die Vergabe eines externen Auftrags erfolgen im Laufe des Jahres 2025. | • Hitzeinseln – Informationen und Massnahmenkatalog für Freiburger Gemeinden: https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-06/hitzeinsel--informationen-und-massnahmenkatalog-fur-freiburger-gemeinden.pdf • Projekt OS Jolimont: • Bericht: https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/s55-et-s13-resultats-jolimont.pdf • Anhänge: https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/20240605_ResultatsJolimont_Annexes.pdf • Medienspiegel OS Jolimont: https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-09/Revue%20de%20presse%20Jolimont%202024-avec%20compression.pdf | |
| S.1.4 | Realisierung und Implementierung eines Sensibilisierungsprogramms für klimatische Herausforderungen für Stadtplanerinnen und Stadtplaner sowie Fachpersonen der Baubranche | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 120 000 CHF | Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Ein Programm mit unterschiedlichen Sensibilisierungsaktionen für Akteure der Siedlungsgestaltung und des Bauwesens soll aufgestellt werden. Es betrifft insbesondere die Phänomene Oberflächenabfluss und starke Hitze. Die durchgeführten Aktionen richten sich an verschiedene Zielgruppen (Gemeindeverwaltungen, Fachleute aus dem Bauwesen und der Stadtplanung usw.) und ermöglichen es einerseits, die Phänomene und die damit verbundenen Risiken bekannt zu machen, und andererseits, Wege aufzuzeigen, wie diese Gefahren und ihre Folgen begrenzt werden können. Im Rahmen der UVP wird die Klimathematik an einem Weiterbildungstag für auf UVP spezialisierte Büros angeboten. | - | - | - | - | - | - | - | |
| S.1.5 | Sensibilisierung von praktizierenden und angehenden Architektinnen und Architekten für die Klimathematik | 85% | 15% | Staat FR, Vereinigungen, Bevölkerung | 130 000 CHF | Hochbauamt (HBA) und Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2024-2026 | Marie Pichard | Aufbau eines Projekts (Weiterbildung, Kurs usw.) mit dem Ziel, Architektinnen und Architekten und/oder Studierende der Architektur für den Klimawandel zu sensibilisieren, damit sie die damit verbundenen Herausforderungen in ihre Berufstätigkeit integrieren können. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.1.5 besteht darin, die Projektleiterinnen und ‑leiter des Hochbauamts für Konzepte im Zusammenhang mit grauer Energie zu sensibilisieren und Einrichtungen (Vereine, Schulen) zu unterstützen, die diese Sensibilisierung bei einem breiteren Publikum durchführen. | - | - | - | Es wurde eine finanzielle Unterstützung für die Organisation eines Schulungstages zum Thema Kreislaufwirtschaft für 50 Projektleiterinnen und ‑leiter des Hochbauamts gewährt. An diesem Tag wurden der aktuelle rechtliche Rahmen und die Integration der Kreislaufwirtschaft in Ausschreibungen und Pflichtenhefte behandelt. Praktische Übungen und interaktive Sitzungen rundeten den Tag ab. Darüber hinaus wurde die Ressourcerie bei der Organisation von Workshops und Präsentationen zum Thema Wiederverwendung unterstützt. | Die Sensibilisierungsmassnahmen, die sowohl innerhalb des Staats als auch darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den Akteurinnen und Akteuren, die sich für den kohlenstoffarmen Bau engagieren, durchgeführt werden, sollten fortgesetzt werden. | - | |
| S.1.6 | Durchführung von Informations- und Sensibilisierungsaktionen für Naturgefahren | 0% | 0% | Gemeinden, Bevölkerung | 125 000 CHF | Naturgefahrenkommission (NGK) | Im Gang | 2024-2026 | Paul Rwakabayiza | Für alle betroffenen Akteure (Politikerinnen und Politiker, Gemeinden, Versicherungen, Eigentümerinnen und Eigentümer, Bevölkerung usw.) werden Informations- und Sensibilisierungsaktionen hinsichtlich der Risiken und Auswirkungen des Klimawandels auf die Naturgefahren durchgeführt. | Der Klimawandel wirkt sich auf das Gebiet und die Gesellschaft aus, indem er die Wahrscheinlichkeit des Auftretens und die Intensität von gefährlichen Naturprozessen (Hochwasser, Erdrutsche, Stürme usw.) verändert. Dieses Thema muss in die Kommunikationsmassnahmen zu Naturgefahren integriert werden, um die damit verbundenen Risiken zu verringern. | - | - | - | Im Hinblick auf die Entwicklung einer Kommunikationskampagne zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Naturgefahren fanden Diskussionen innerhalb der Naturgefahrenkommission statt (unter Beteiligung des BRPA, AfU, WNA und der KGV). Diese Kampagne richtete sich an die Gemeinden und hatte zum Ziel, die Anpassungsfähigkeit des Kantonsgebiets an den Klimawandel sicherzustellen, um die Bevölkerung, Gebäude und Infrastrukturen zu schützen. Zu diesem Zweck wurde ein Pflichtenheft erstellt, um Kommunikationsagenturen zu beauftragen. | Zunächst wird eines der von den konsultierten Kommunikationsagenturen vorgeschlagenen Konzepte ausgewählt werden. Anschliessend soll das Konzept weiterentwickelt und verbreitet werden. | - | |
| S.1.7 | Anpassung der Empfehlungen für die Forstwirtschaft und Information von Waldeigentümerinnen und ‑eigentümern | 100% | 65% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen | 186 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2022-2025 | Gaël Berther | Berücksichtigung von Klimafragen in den Empfehlungen für die Waldbewirtschaftung. Für die Waldeigentümerinnen und ‑eigentümer werden Informations- und Sensibilisierungsaktionen über die notwendigen Massnahmen zur Verstärkung der Widerstandskraft der Wälder (Verjüngung, Erhöhung der Diversität von Baumarten und ‑strukturen) durchgeführt. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.1.7 ist es, Entscheidungshilfen für Försterinnen und Förster zu entwickeln und diese über eine Plattform zugänglich zu machen. Schliesslich wird eine Schulung organisiert werden, damit alle Tools ab 2025 (Beginn der nächsten Programmvereinbarung des Bundes) einsatzbereit sind. | - | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden Entscheidungshilfen für Försterinnen und Förster entworfen und in das kantonale Instrumentarium integriert: • Vergleichstabelle zur Erleichterung der Auswahl von Baumarten, die an das zukünftige Klima angepasst sind; • Integration der Kartografie der Waldgesellschaften des Kantons in die Anwendung treeapp. | Im zweiten Jahr der Umsetzung wurden folgende Massnahmen verwirklicht: •mit Grangeneuve koordinierte Ausbildung für die Pflege von Jungbeständen; •Entwicklung von Werkzeugen zur Entscheidungsunterstützung und Integration in Forestmap (Arbeitsplattform, kartografisches Werkzeug für Forstverwalter/innen). | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Aktualisierung der neuen Version des Klimawandel-Cockpits für Wälder und Zusammenarbeit mit Tree-app 2.0 zur Integration neuer Karten; • Weiterbildung für Försterinnen und Förster zu den Themen Pflege junger Bestände und Klimawandel; • Ausbildung in Grangeneuve für Forstwartlernende; • Aktualisierung der Richtlinien, insbesondere für die Pflege junger Bestände und Waldschäden. | Für die weitere Umsetzung müssen folgende Massnahmen getroffen werden: • Verbesserung der Zugänglichkeit und Bereitstellung von Dokumentationen für Försterinnen und Förster; • Integration des Vermehrungsguts in das Kartenportal des BAFU und in die kantonalen Instrumente sowie Information der Försterinnen und Förster; • Verwendung der zukünftigen Verbreitungskarten und Integration in bestehende Instrumente; • Strategie für forstliche genetische Ressourcen: Integration des Prozesses in die verschiedenen strategischen Elemente der Zentrale des WNA. | • Aktionsplan: Anpassung der Freiburger Wälder an den Klimawandel: https://www.fr.ch/de/ilfd/wna/news/aktionsplan-anpassung-der-freiburger-waelder-an-den-klimawandel • Anwendung der WSL–Empfehlungen zu den Empfehlung der Essenzen: https://www.tree-app.ch/ | |
| S.1.8 | Entwicklung neuer Versicherungsleistungen für Landwirtinnen und Landwirte | 85% | 35% | Landwirtschaftsbetriebe | 200 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2024-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Zur Identifikation der durch den Klimawandel bedingten neuen Risiken für die Landwirtschaft, die nicht durch die Versicherungen gedeckt sind, und zur Identifikation der Handlungsmöglichkeiten und Massnahmen zur Verbesserung der Situation wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt; Entwicklung von Versicherungsleistungen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme besteht darin, den Klimaplan Landwirtschaft zu unterstützen. | - | - | - | Im Jahr 2024 ermöglichte die Massnahme die Umsetzung des Projekts AgroImpact für staatliche Landwirtschaftsbetriebe und die Unterstützung des Projekts Staffelkulturen. | Im Jahr 2025 soll die Unterstützung des Projekts Staffelkulturen fortgesetzt werden. | • https://no-till.ch/projekte/ •https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/klimaplan-landwirtschaft/projekte#projekt-simone | |
| S.1.9 | Antrag auf Anpassung des Lehrplans für künftige Landwirtinnen und Landwirte | 0% | 5% | Bevölkerung | 50 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Analyse des Anpassungsbedarfs des Lehrplans durch die betroffenen Akteure (FBV, GVBF usw.). Integration der durch den Klimawandel bedingten Herausforderungen in die Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten (insbesondere hinsichtlich der Bewässerung). | Überlegungen zur Integration von Klimafragen in den Lehrplan der landwirtschaftlichen Ausbildung und Organisation von Veranstaltungen zur Sensibilisierung der Studierenden. | - | - | Im ersten Jahr der Umsetzung ermöglichte diese Massnahme die Organisation einer Pädagogische Tagung im August 2023 mit der Durchführung von 2 Workshops zum Klimafresko. | - | Im Jahr 2025 soll die Massnahme in den Klimaplan Landwirtschaft aufgenommen werden. | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/klimaplan-landwirtschaft | |
| S.1.10 | Durchführung von Aktionen zur Begrenzung der Erosion landwirtschaftlicher Flächen | 100% | 35% | Bevölkerung | 150 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Für die Betreiberinnen und Betreiber landwirtschaftlicher Betriebe wird eine Schulungskampagne durchgeführt, um sie dazu anzuregen, die Wasserrückhaltefähigkeit ihrer Böden zu verbessern und die Erosion der Parzellen zu begrenzen (Bodenbedeckung, Erhöhung des Gehalts organischer Stoffe im Boden usw.). Je nach Bedarf kann den besonders von der Problematik betroffenen Betreiberinnen und Betreibern während der Sensibilisierungsphase Unterstützung bei der Verbesserung ihrer besonders betroffenen Parzellen angeboten werden; gegebenenfalls können auch verstärkt Kontrollen durchgeführt werden. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.2.3, S.5.10, S.5.11, A.1.1 und A.5.2) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | ||
| S.1.11 | Erstellung von Kommunikationsmitteln zu den guten Praktiken, die der Anpassung an den Klimawandel in der Landwirtschaft dienen | 85% | 45% | Bevölkerung | 150 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Es werden Kommunikationsmittel (Kampagnen, Arbeitsgruppen usw.) zur Erhöhung der Resilienz der Landwirtschaft gegenüber dem Klimawandel angeboten. Diese betreffen sowohl die Tier- als auch die Pflanzenproduktion und sind von allen Freiburger Betreiberinnen und Betreibern einfach zu verwenden. Diese Massnahme beinhaltet auch die Durchführung von Informations- und Sensibilisierungsaktionen zum Gewässerschutz in der Landwirtschaft. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme S.5.12) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Kommunikation»). | - | - | ||
| S.2.1 | Kommunale Klimaplanungen und Durchführung von Projekten zur Anpassung an starke Hitze | 15% | 10% | Gemeinden, Bevölkerung | 1 000 000 CHF | Amt für Gesundheit (GesA) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Hilfe zur Ausarbeitung von kommunalen Klimaplänen und zur Durchführung partizipativer Projekte, deren Ziel die Begrenzung gesundheitlicher Risiken von vulnerablen Personen (Betagte, Kinder, Jugendliche usw.) während Hitzeperioden ist. Unterstützung von Gemeinden, die ein Projekt zur Neugestaltung oder Schaffung von öffentlichen Räumen durchführen, das den Klimaschutzaspekt und die Bekämpfung von Hitzeinseln einbezieht. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.2.1 ist es, die Gemeinden für die Thematik der Hitzeinseln zu mobilisieren, indem ihnen konkrete, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Handlungsmöglichkeiten angeboten werden. Daher sollen die Gemeinden bei der Umsetzung von Projekten zur Gestaltung des öffentlichen Raums, die den Klimakomfort und die körperliche und geistige Gesundheit der gefährdeten Bevölkerungsgruppen fördern, finanziell unterstützt werden (Subventionierung «Klima PLUS in Verbindung mit Hitzeinseln und Gesundheit»). | - | Überlegungen innerhalb des Amts für Gesundheit (GesA), in Zusammenarbeit mit dem Amt für Umwelt (AfU) und mit verschiedenen potenziellen Partnern zu Umsetzungsmöglichkeiten und zur Projektsteuerung. Auftrag an Biol Conseil für technische Unterstützung erteilt. | Die Umsetzung dieser Massnahme hat im ersten Jahr Folgendes ermöglicht: • Schaffung einer dienststellenübergreifenden Arbeitsgruppe (GRETEF, Gemeinde Freiburg, WNA, SVA, HTA-FR, JA, Gemeindeverband und AfU); •Schaffung eines Katalogs von Modellaktionen, um die Gemeinden bei der Integration von Klima- und Gesundheitsfragen in ihre Projekte, die sich auf gefährdete Personen auswirken, zu leiten und sie zu inspirieren; •Aufnahme von Arbeiten zur Regelung der Gewährung von Subventionen an Gemeinden (Verordnung des SR). | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Start der Projektaufrufe für Gemeinden; • Beginn der Gewährung von Subventionen an die Gemeinden des Kantons. | Für die weitere Umsetzung werden folgende Massnahmen erwartet: • Fortsetzung der Gewährung von Subventionen an die Gemeinden; • Kommunikation zur Massnahme S.2.1 mit den Gemeinden als Zielgruppe. | • Massnahmenkatalog: https://www.fr.ch/de/document/530671">https://www.fr.ch/de/document/530671 • Flyer: https://www.fr.ch/de/document/530671">https://www.fr.ch/de/document/530671 • Verordnung über die Unterstützung kommunaler Massnahmen zugunsten von Projekten zur Anpassung an starke Hitze: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/815.14 | |
| S.2.2 | Unterstützung bei der Überwachung der Vektoren von Infektionserkrankungen, die durch den Klimawandel begünstigt werden | 20% | 40% | Staat FR, Bevölkerung | 50 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Quentin Pointet | Der Klimawandel kann die Entwicklung von Infektionskrankheiten (neue oder bereits existierende) in der Schweiz begünstigen. Die Massnahme dient vor allem dem Erreichen folgender Ziele: •Unterstützung bei der Überwachung von Infektionskrankheiten, die durch den Klimawandel begünstigt werden; •Unterstützung bei der Überwachung der Vektoren von Infektionskrankheiten, die durch den Klimawandel begünstigt werden; •Einrichtung einer Arbeitsgruppe zum Monitoring der Vektoren (beispielsweise der Tigermücke) im Kanton; •Unterstützung des interkantonalen Monitoringprojekts zur Tigermücke. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.2.2 ist die Förderung der Überwachung von Infektionserkrankungen und ihrer Vektoren, die durch den Klimawandel begünstigt werden. | Einrichtung eines Monitorings der Tigermücke in der Umgebung der Autobahn-Raststätte Greyerz. Es wurden Fallen aufgestellt, Proben entnommen und zur Analyse verschickt. | Einrichtung eines Monitorings der Tigermücke in der Umgebung der Autobahn-Raststätte Greyerz und des Flugplatzes von Ecuvillens. Es wurden Fallen aufgestellt, Proben entnommen und zur Analyse verschickt. | •Einrichtung eines Monitorings der Tigermücke in der Umgebung der Autobahn-Raststätte und des Parkplatzes Greyerz. Es wurden Fallen aufgestellt, Proben entnommen und zur Analyse verschickt. •Festlegung der Modalitäten sowie der mit dem Monitoring und den Interventionen zu beauftragenden Stellen. In diesem Sinne muss eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Überwachung von Krankheitsüberträgern befasst, gemeinsam mit dem Kantonsarztamt (KAA), dem Amt für Wald und Natur (WNA) und dem Amt für Umwelt (AfU) eingerichtet werden. | Die Überwachung beim Parking de Gruyères wurde durchgeführt. Eine Reihe von Kommunikationsunterlagen wurde im Hinblick auf eine Kampagne im Jahr 2025 in Auftrag gegeben. | Für die weitere Umsetzung werden folgende Massnahmen erwartet: Einrichtung eines Monitorings der Tigermücke in der Umgebung des Parkings de Gruyères. Es wurden Fallen aufgestellt, Proben entnommen und zur Analyse verschickt. • Durchführung einer Kommunikationskampagne in Zusammenarbeit mit den Westschweizer Kantonen; • Einrichtung einer Arbeitsgruppe und Erstellung eines Aktionsplans für den Fall, dass Populationen von Tigermücken entdeckt werden. | - | |
| S.2.3 | Verstärkung des Netzwerks zur Beobachtung der Bodenfeuchtigkeit | 100% | 40% | Bevölkerung | 300 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Es wird ein Monitoring der Bodenfeuchtigkeit anhand von Sonden entwickelt. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.5.10, S.5.11, A.1.1 und A.5.2) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | ||
| S.3.1 | Berücksichtigung der mit dem Klimawandel einhergehenden gesundheitlichen Risiken in der Personalpolitik des Staats | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 50 000 CHF | Amt für Personal und Organisation (POA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Die neue Personalpolitik beinhaltet Massnahmen zur Förderung und zum Schutz der Gesundheit der Staatsangestellten in Verbindung mit dem Klimawandel. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.4.1 | Integration der Thematik meteorologische Extremereignisse in die Gesetzesgrundlagen | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Falls erforderlich, werden die gesetzlichen Grundlagen (insbesondere RPBG, GewG usw.) dahingehend angepasst, dass darin die durch meteorologische Extremereignisse (grosse Hitze, Oberflächenabfluss, Überschwemmungen durch Fliessgewässer, Hagel, Gewitter usw.) bedingten Herausforderungen mitberücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Akteure hinsichtlich dieser Ereignisse werden geklärt. Insbesondere ist die Einführung raumplanerischer und baulicher Massnahmen, die diese klimatischen Probleme vermeiden oder ihre Auswirkungen begrenzen sollen, vorgesehen. Diese Massnahmen betreffen unter anderem die Ausrichtung und die Lage der Gebäude sowie die Bodennutzung und die landschaftliche und architektonische Gestaltung (Materialien, helle Farben). | - | - | - | - | - | - | ||
| S.4.2 | Verbesserte Integration der klimatischen Herausforderungen in die Gesetzesgrundlagen und die Strategien für den Freiburger Tourismus | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Die Herausforderungen, die mit den Bereichen Nachhaltigkeit und Klima in Verbindung stehen, werden sektorenübergreifend in die Gesetzesgrundlagen und die Strategien integriert, die mit dem Tourismus im Kanton Freiburg in Verbindung stehen. Dies kann beispielsweise mit dem Instrument Kompass21 erreicht werden. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.4.3 | Integration der klimatischen Herausforderungen in den kantonalen Richtplan | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 15 000 CHF | Bau- und Raumplanungsamt (BRPA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Quentin Pointet | Die klimatischen Herausforderungen werden mit ihren unterschiedlichen Themenbereichen (Wasser, Biodiversität, Bodenschutz, Wald, Gesundheit, Naturgefahren) bei künftigen Revisionen in den kantonalen Richtplan integriert, damit die Raumentwicklung in Einklang mit den Zielen des kantonalen Klimaplans steht. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.5.1 | Umsetzung von Massnahmen zur Bekämpfung der Entwicklung von Legionellen, deren Verbreitung durch starke Hitze begünstigt wird | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 100 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Quentin Pointet | Den betroffenen Akteuren werden anhand von Informations- und Sensibilisierungsaktionen gute Praktiken vermittelt, deren Ziel es ist, die durch starke Hitze begünstigte Verbreitung von Legionellen zu verhindern. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.5.2 | Integration der klimatischen Herausforderungen in die Immobilienstrategie des HBA und bei der Planung und Renovierung von Staatsgebäuden | 0% | 50% | Staat FR | 50 000 CHF | Hochbauamt (HBA) | Im Gang | 2023-2026 | Marie Pichard | Die klimatischen Herausforderungen werden unter Berücksichtigung ihrer gesundheitlichen Auswirkungen in die Immobilienstrategie des HBA sowie bei der Planung, der Renovierung und den Aussenanlagen integriert. | Weil die Immobilienstrategie schon vor der Umsetzung dieser Massnahme festgelegt wurde, wird das Ziel nun darin bestehen, Projekte zur Sanierung von Gebäuden zu unterstützen, die als Grossverbraucher identifiziert wurden. | - | - | Die Umsetzung dieser Massnahme hat es ermöglicht, mehrere Energieaudits für Verbraucher, die keine Grossverbraucher sind, zu finanzieren: •Gebäude der Route des Daillettes 6-6a in Freiburg; •Kollegium Gambach, Rue Weck-Reynold 9-9b-9c-9d in Freiburg. | - | Die Massnahme sollte es ermöglichen, ein Pflichtenheft zu erstellen, das die im Energiegesetz vorgesehenen Bestimmungen für Heizung und Klimatisierung enthält. | - | |
| S.5.3 | Berücksichtigung des Klimawandels beim Schutz gegen die Naturgefahren Lawinen und instabiles Gelände | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 110 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Gaël Berther | Die Gefahrenkarten werden unter dem Blickwinkel des Klimawandels neu bewertet (Berücksichtigung der Ergebnisse der Klimaszenarien und der Empfehlungen des Bundes). Auch die Konzeption von Schutzbauten wird an diese Szenarien angepasst. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.5.4 | Berücksichtigung des Klimawandels beim Schutz gegen die Naturgefahr Wasser | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 200 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Paul Rwakabayiza | Die Gefahrenkarten werden unter dem Gesichtspunkt des Klimawandels neu bewertet (Berücksichtigung der Ergebnisse der Klimaszenarien, der Szenarien Hydro-CH2018 sowie der Empfehlungen des Bundes). Auch die Konzeption von Schutzbauten wird an diese Szenarien angepasst (robuste, anpassungsfähige und widerstandsfähige Systeme, Überlastungsmanagement). | - | - | - | - | - | - | ||
| S.5.5 | Anpassung der Schulen an den Klimawandel | 75% | 65% | Staat FR, Gemeinden, Bevölkerung | 350 000 CHF | Amt für Gesundheit (GesA) | Im Gang | 2021-2025 | Melinda Zufferey-Merminod | Berücksichtigung der mit dem Klimawandel in Verbindung stehenden Gesundheitsrisiken bei Schülerinnen und Schülern im Rahmen der Revision des Konzepts «Gesundheit in der Schule» und seines Aktionsplans sowie bei der Umsetzung. | Die Massnahme S.5.5 hat das übergeordnete Ziel, die klimatischen Herausforderungen in das Konzept «Gesundheit in der Schule» einzubinden. Sie unterstützt ausserdem die Umsetzung von Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in Schulen und Bildungseinrichtungen. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Unterstützung des Büros Gesundheit in der Schule (durch Bio-Eco) bei der Revision des Konzepts «Gesundheit in der Schule», damit die Berücksichtigung der klimatischen Aspekte gewährleistet werden kann. In diesem Rahmen wurden partizipative Workshops zur Sammlung von Elementen für die Überarbeitung des Konzepts «Gesundheit in der Schule» durchgeführt; • Unterstützung von Klassen oder Schulen bei der Entwicklung einer Klimastrategie; • Unterstützung bei der Durchführung von sechs Workshops zur Anpassung an den Klimawandel in Schulen und Lernorten (Primarschule Neyruz, Primarschule Auge in Freiburg, Primarschule Schmitten, Primarschule Vuadens, Orientierungsschule Pérolles in Freiburg, Orientierungsschule Cugy). | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Fortsetzung der Unterstützung von Klassen oder Schulen bei der Ausarbeitung einer Klimastrategie; • Unterstützung bei der Umsetzung konkreter Massnahmen im Anschluss an die Workshops in Schulen und Bildungsstätten (Primarschule Neyruz, Primarschule Auge in Freiburg, Primarschule Schmitten, Primarschule Vuadens, Orientierungsschule Pérolles in Freiburg, Orientierungsschule Cugy). | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: •Das Konzept Gesundheit in der Schule 2023–2027 wurde im März 2023 formell verabschiedet; •Eine Begleitung wurde bei der Grundschule in Tafers sowie bei der Villa Thérèse durchgeführt. | Mehrere Einrichtungen – die OS Jolimont im Rahmen der Umsetzung des Pilotprojekts, das in die Massnahme S.1.3 integriert ist, die Orientierungsschule Cugy, die Schule La Vignettaz sowie die Schule Saint-Martin – wurden vom Auftragnehmer begleitet. | Die Ziele für 2025 bestehen darin, die bereits beteiligten Einrichtungen weiterhin zu unterstützen und weitere Einrichtungen zu fördern. Ausserdem soll das Projekt «Schulen trotzen der Hitze» weiterentwickelt werden, das aus einem vom Bund unterstützten Pilotprojekt hervorgegangen ist. | • Aufruf zur Teilnahme für Schulklassen und Bildungseinrichtungen des Kantons: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/raum-und-gesellschaft/massnahme-s-5-5-anpassung-der-schulen-an-den-klimawandel.html • Projekt der OS Jolimont (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/s55-et-s13-resultats-jolimont.pdf • https://etatfr.sharepoint.com/:b:/r/teams/SEn-MesuresPCCTerritoireetSociete-S55AdaptationCCcoles/Documents%20partages/S55%20Adaptation%20CC%20%C3%A9coles/Rapports/20250131_rapport_restitution_de%CC%81marche_St-Martin.pdf?csf=1&web=1&e=QaLfit • https://etatfr.sharepoint.com/:b:/r/teams/SEn-MesuresPCCTerritoireetSociete-S55AdaptationCCcoles/Documents%20partages/S55%20Adaptation%20CC%20%C3%A9coles/Rapports/Zusammenfassiung_Umsetzung_Klimaplan_Schule_Tafers(1).pdf?csf=1&web=1&e=0iTEQr | |
| S.5.6 | Durchführung von Massnahmen zur Verbesserung des Komforts in Gebäuden im Sommer | 0% | 45% | Staat FR, Bevölkerung | 220 000 CHF | Hochbauamt (HBA) und Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Gewährleistung eines optimalen Komforts im Inneren der Gebäude (neue und bestehende) während des Sommers, insbesondere durch die Einführung passiver Kühlungsmassnahmen. Die Beschreibung dieser Massnahmen wird in die Baubewilligungsdossiers integriert. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.5.6 ist die Verbesserung des Komforts im Sommer insbesondere durch die Erstellung einer Liste von Parametern, die bei der Erneuerung oder dem Bau von öffentlichen und/oder privaten Gebäuden berücksichtigt werden müssen. | Die Massnahme S.5.6 führte zu folgenden Ergebnissen: • Erstellung einer Liste von Parametern, die zur Erhöhung des thermischen Komforts beitragen; • Analyse der gesetzlichen Grundlagen und anderer Instrumente, damit verbindliche Massnahmen und Empfehlungen eingebunden werden können; • Bestimmung der Gebäude, die hinsichtlich des thermischen Komforts Priorität haben, und Beginn der Analysen durch ein Ingenieurbüro; • Besuche von Expertinnen und Experten in fünf Gebäuden zur Analyse der Problematik der sommerlichen Überhitzung und der verfügbaren passiven und aktiven Mittel zur Verbesserung des thermischen Komforts der Benutzerinnen und Benutzer an den verschiedenen Standorten; • Einreichung von zwei Angeboten von Dienstleistern für die Durchführung von Korrekturmassnahmen. | Die Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Finanzierung eines Audits ausgewählter staatlicher Gebäude; • Durchführung von Arbeiten an den Fenstern im Museum für Kunst und Geschichte. | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: •Durchführung von Arbeiten beim Polizeigebäude (Place Notre-Dame 2) zum Austausch der festen Lichtkuppeln durch motorisierte Lichtkuppeln mit dem Ziel, die Räume während der heissen Jahreszeiten belüften zu können, da die Isolierung des Daches schwach ist und dies die einzige vernünftige Möglichkeit ist, die Temperatur zu senken oder für etwas Luft zu sorgen; •Durchführung von Renovierungsarbeiten beim Oberamt des Saanebezirks. | Diese Massnahme wurde 2024 ausgesetzt. | Für die weitere Umsetzung werden punktuelle Projekte identifiziert werden müssen, deren finanzielle Unterstützung für die Erreichung des Ziels dieser Massnahme relevant ist. | - | |
| S.5.7 | Koordination der Integration meteorologischer Extremereignisse in die Politikbereiche | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 100 000 CHF | Naturgefahrenkommission (NGK) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Noch nicht definiert | Eine Arbeitsgruppe mit unterschiedlichen Akteuren, die sich mit den meteorologischen Extremereignissen (Gewitter, Hagel usw.) befassen, wird eingesetzt, damit diese Phänomene koordiniert und wirksam in die Staatshandlungen und ‑strategien integriert werden können. | - | - | - | - | - | - | ||
| S.5.8 | Verstärkung der Präventionsmassnahmen gegen Waldbrände | 45% | 75% | Staat FR, Gemeinden, KGV | 120 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2023-2025 | Gaël Berther | Es werden Einsatzpläne für jeden Sektor und Konzepte zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden erstellt oder bestehende Konzepte angepasst, um dem durch den Klimawandel gestiegenen Waldbrandrisiko begegnen zu können. | Die Umsetzung dieser Massnahme ist auf folgende Ziele ausgerichtet: 1. Gruppierung der Waldgebiete nach Waldbrandrisiko und verfügbaren Löschmitteln 2. Erstellung von kantonalen Empfehlungen für die Umsetzung von forstwirtschaftlichen Massnahmen, die das Waldbrandrisiko senken 3. Detaillierte Bewertung der Infrastruktur zur Brandbekämpfung sowie der verfügbaren Löschmittel (Ausrüstung, Material, Fahrzeuge usw.) 4. Vorschläge zur Verbesserung der Verteidigungs- und Löschmittel, wo diese als unzureichend erachtet werden 5. Einrichtung einer Konferenzreihe zur Schulung der Revierförsterinnen und ‑förster | - | - | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: •Einführung der zweijährigen Konferenzreihe (2 im Jahr 2023 und 2 im Jahr 2024); •Erstellung von Einsatzkarten «Waldbrand» für die Feuerwehrbataillone für den gesamten Kanton; •Überlegungen zum Pflichtenheft des WNA-Ansprechpartners für Waldbrände (wenn ein Brand ausbricht, welche Unterstützt kann das WNA der Feuerwehr bieten?); •Entwurf der Grundsätze einer Forstwirtschaft, die zur Verhinderung von Waldbränden beiträgt. | Im zweiten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: • Durchführung von zwei Konferenzen im Jahr 2024 (19 und 13 Teilnehmende); • Fertigstellung der Grundsätze einer Forstwirtschaft, die zur Verhinderung von Waldbränden beiträgt; • Definition des Pflichtenhefts des WNA-Beauftragten für Waldbrände (1. Halbjahr 2024) und Klärung der Finanzierung; • Durchführung im Sommer 2024 einer gross angelegten Übung unter Beteiligung der Feuerwehr und der Armee; • Erstellung einer ersten Fassung des kantonalen Konzepts zur Waldbrandprävention und ‑bekämpfung. | Für die weitere Umsetzung sind folgende Massnahmen vorgesehen: • Umsetzung der Kommunikationsstrategie für die Bevölkerung und die Behörden; • Layout des kantonalen Konzepts; • Bereitstellung von Kommunikationsmaterial für die Gemeinden (Plakate, Schilder usw.); • wenn noch Mittel verfügbar sind, Test mit vorbeugenden forstwirtschaftlichen Massnahmen. | - | |
| S.5.9 | Unterstützung forstlicher Massnahmen zur Anpassung von Waldgebieten an den Klimawandel | 105% | 75% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen | 264 000 CHF | Amt für Wald und Natur (WNA) | Im Gang | 2022-2025 | Gaël Berther | Unterstützung von forstwirtschaftlichen Massnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Standortuntaugliche Waldbestände werden in angepasste Bestände überführt. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.5.9 ist es, den Fortbestand der Freiburger Wälder zu sichern. Um dies zu erreichen, wird die Massnahme in drei Phasen umgesetzt. Zunächst wird eine Vorstudie durchgeführt, um die am stärksten gefährdeten Bestände zu identifizieren. Danach beginnt die Phase der prioritären Eingriffe in den privaten und öffentlichen Wäldern des Kantons. Anschliessend werden diese Eingriffe überwacht und bewertet, um die Relevanz von grossflächigen Eingriffen zu bestimmen. | - | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden anhand eines Aktionsplans (intern im Amt für Wald und Natur) rund 10'000 Hektar potenziell gefährdeter Wälder identifiziert, da diese anfälliger für den Klimawandel sind. Auf dieser Grundlage wurde ein Auftrag an ein privates Büro vergeben, die prioritären Sektoren nach Massgabe des Budgets zu bestimmen sowie die Interventionen zu planen und über den gesamten Umsetzungszeitraum zu verteilen. | Im zweiten Jahr der Umsetzung wurden folgende Massnahmen verwirklicht: •In den 4 Forstkreisen des Kantons fanden 6 Interventionen (Holzschläge) in gefährdeten Beständen statt. •Im Rahmen der Kommunikation wurde eine Medienmitteilung auf fr.ch veröffentlicht und es wurden Informationsposter am Ort der Holzschläge aufgestellt. •Die Koordination mit der WSL wurde für das Follow-up im Jahr 2024 organisiert. | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Durchführung von Massnahmen gemäss dem von der WSL bereitgestellten Protokoll zu den Feldaufnahmen für die acht Bestände, die Gegenstand des Forschungsprojekts waren; • Übernahme des Protokolls in den kommenden Jahren von weiteren Kantonen. | Für die weitere Umsetzung müssen folgende Massnahmen getroffen werden: • Wartung und Aktualisierung der Instrumente im Zusammenhang mit dem Klimawandel (Cockpit); • Integration der Planungsinstrumente. | • Medienmitteilung zu den waldbaulichen Arbeiten: https://www.fr.ch/de/ilfd/wna/news/waldbauliche-arbeiten-fuer-bessere-klimaresistenz-der-freiburger-waelder • Beispiel für ein Plakat, das die Bevölkerung über die Gründe für die Massnahmen informiert: https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-11/infographie-sfn--travaux-forestiers-pour-adapter-les-forets-au-changement-climatique.pdf | |
| S.5.10 | Durchführung von Begleitmassnahmen hin zu einer gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähigen Landwirtschaft | 70% | 80% | Bevölkerung | 200 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung von Begleitmassnahmen für eine gegenüber dem Klimawandel widerstandsfähigen Landwirtschaft mittels guter Praktiken (Smart Farming, Agroforstwirtschaft, bodenkonservierende Landwirtschaft, Auswahl angepasster Arten usw.). | Die Massnahme S.5.10 hat die Durchführung von Begleitmassnahmen für eine klimaresiliente Landwirtschaft zum übergeordneten Ziel und unterstützt hierfür namentlich das Smart Farming, die Agroforstwirtschaft, die bodenkonservierende Landwirtschaft sowie die Auswahl geeigneter Arten. Des Weiteren fördert sie die Entwicklung eines Gesamtüberblicks über den Wasserbedarf zur Bewässerung, damit gewährleistet ist, dass die Kulturen ausreichend versorgt und die Fliessgewässer in Trockenperioden entlastet sind. Einige Betreiberinnen und Betreiber haben bereits interessante Massnahmen ergriffen, die vor allem auf die Bewältigung des durch den Klimawandel bedingten erhöhten Wasserbedarfs ausgerichtet sind. Während bestimmter Vegetationsphasen ist die Bewässerung besonders wichtig, damit die Produktion und die von den Verbraucherinnen und Verbrauchern erwartete Qualität gewährleistet werden können. | Beginn einer Studie, die die Aufrechterhaltung eines kohärenten Vorgehens bei der Entwicklung von Bewässerungsanlagen ermöglichen soll, mit dem Hauptziel, den zur Bewässerung notwendigen Wasserbedarf zu ermitteln und diesen Bedarf mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu vergleichen, wobei die neuen klimatischen Szenarien sowie die Szenarien HYDRO-CH2018 berücksichtigt wurden. Diese Studie war Gegenstand des Expertenberichts «Besoins en eau d’irrigation dans le canton de Fribourg» (Wasserbedarf für die Bewässerung im Kanton Freiburg), der bestätigt, dass sich der Kanton Freiburg mit seiner Bewässerungsstrategie auf dem richtigen Weg befindet. Letztere bevorzugt Entnahmestellen in den Seen und den grossen Fliessgewässern, damit während der gesamten Vegetationszeit eine zuverlässige und ausreichende Wasserversorgung gewährleistet ist und dabei gleichzeitig die Oberflächengewässer geschützt werden. | Im Rahmen eines partizipativen Prozesses werden ausgewählte Büros mit der Durchführung einer Vorstudie mit folgendem Mandat beauftragt: • Landwirtinnen und Landwirte (Priorität 1) und Vertreter der Wertschöpfungskette (Priorität 2) wissen, dass es die der Landwirtschaft gewidmeten Massnahmen des Klimaplans gibt und kennen die Kontaktstellen. • Die Konsumentinnen und Konsumenten (Prio 3) wissen, dass die Freiburger Landwirtschaft aktiv am Klimaplan im Kanton Freiburg teilnimmt. Zudem wurde das Projekt «HERAKLES Plus» unterstützt. In diesem Projekt wird ein resilientes Produktionssystem für Mostobst für die Zukunft mit robusten Sorten und nachhaltigen Massnahmen zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen erforscht. | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10,S.2.3,S.5.11, A.1.1 und A.5.2) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | ||
| S.5.11 | Ermutigung der Agroforstwirtschaft, die Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft an den Klimawandel zu verbessern | 50% | 20% | Bevölkerung | 160 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung der Anmeldungen von Landwirtinnen und Landwirten für den Kurs über Agroforstwirtschaft. Der Kanton Freiburg wird darin unterstützt, am Programm Agroforstwirtschaft teilzunehmen (Projekt Ressourcen). Finanzielle Unterstützung zur Anpflanzung von Bäumen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme S.5.11 ist es, die Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft an den Klimawandel zu erhöhen. Es geht darum: • eine Definition der modernen Agroforstwirtschaft zu liefern, um ein gemeinsames Verständnis zu schaffen; • eine Bestandsaufnahme der relevanten Agroforstwirtschaftsaktivitäten im Schweizer Kontext zu machen; • mögliche Synergien mit den verschiedenen bestehenden oder in Vorbereitung befindlichen Projekten zu identifizieren; • interessante Ansätze zu identifizieren, die im Rahmen eines zukünftigen Freiburger Agroforstprojekts verfolgt werden sollten; • konkrete Massnahmen für die Umsetzung vorzuschlagen; • die einzubeziehenden Interessengruppen zu definieren. | - | Die Unterstützung für die Teilnahme des Kantons Freiburg am Agroforstprogramm des Bundes (Ressourcenprojekt) wurde evaluiert, war aber leider nicht mehr möglich, weil das Programm bereits angelaufen war. Dank der Umsetzung dieser Massnahme konnte Agridea mit folgenden Aufgaben beauftragt werden: • eine Diagnose der Agroforstwirtschaftsaktivitäten in der Schweiz zu erstellen; • interessante Wege aufzuzeigen, um ein Agroforstwirtschaftsprojekt zu lancieren; • Beispiele für konkrete Massnahmen/Leistungen zu liefern, die umgesetzt werden können; • einen Workshop mit den beteiligten Akteuren zu organisieren mit dem Ziel, eine Projektidee zu skizzieren; • einen Schlussbericht zu erstellen, der eine Entscheidungsfindung ermöglicht. | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.2.3, S.5.10, A.1.1 und A.5.2) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | • Schlussbericht «L'agroforesterie dans le cadre du plan climat du canton de Fribourg» (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/s511rapportagroforesterie.pdf | ||
| S.5.12 | Organisation von Klimatagen für Landwirtinnen und Landwirte | 95% | 25% | Bevölkerung | 100 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Organisation von Tagen für Landwirtinnen und Landwirte, die auf den Klimawandel sowie seine Konsequenzen für die Landwirtschaft ausgerichtet sind. Während dieses Zeitraums sollen gute Praktiken, Innovationen sowie konkrete Beispiele vermittelt werden. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme S.1.11) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Kommunikation»). | - | - | ||
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich Kommunikation | 90% | 40% | Bevölkerung | 450 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich Kommunikation verwaltet die Kommunikation der Massnahmen des Klimaplans Landwirtschaft. | Der Bereich Kommunikation zielt darauf ab: • die Strategie für die Dachkommunikation zu entwickeln; • die Aktivitäten der anderen Bereiche in Bezug auf die Kommunikation (Website, soziale Medien, interne Kommunikation usw.) zu unterstützen; • den gesamten Prozess in Verbindung mit dem Wettbewerb zu verwalten. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Im ersten Jahr der Umsetzung wurde der Wettbewerb für den Klimaplan Landwirtschaft mit einer Kommunikationskampagne gestartet: •Organisation einer Medienkonferenz zum Start des Wettbewerbs; •Erstellung eines Flyers; •Kampagne in sozialen Netzwerken; Mailing an Landwirtinnen und Landwirte und Veröffentlichung in der Zeitschrift Terre à Terre; •Artikel und Anzeigen in den Medien, soziale Netzwerke; •parallel dazu Ausbau der Seite Klimaplan Landwirtschaft auf der Website grangeneuve-conseil.ch. | Auswahl der Preisträger durch eine unabhängige Jury, Organisation der Preisverleihung mit einer Kommunikationskampagne (Kampagne in sozialen Netzwerken und in den Medien, Dreharbeiten für Videos), ständige Aktualisierung der Webseite grangeneuve-conseil.ch. Ende 2024 wurde eine Ausschreibung veröffentlicht, um eine Kommunikationsagentur mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Kommunikationsmassnahmen zu beauftragen. Am Ende des Verfahrens fiel die Wahl auf die Agentur Volontiers Sàrl. | Die Kommunikationskampagne 2025 richtet sich an die breite Öffentlichkeit und konzentriert sich auf die Bemühungen der Landwirtinnen und Landwirte zum Schutz des Klimas. Ziel dieser Kampagne ist es, die konkreten Massnahmen, die auf den landwirtschaftlichen Betrieben umgesetzt werden, aufzuwerten und sie ehrlich, ohne Übertreibung und mit Bescheidenheit zu präsentieren. MEIN KLIMAPLAN – Mehr als eine Aktion, ein Engagement. Dieser Slogan rückt die Landwirtinnen und Landwirte und ihre konkreten Massnahmen zur Bewältigung der klimatischen Herausforderungen in den Vordergrund. In jedem Kurzvideo kommen sie zu Wort, um ihr Engagement, ihr Know-how und ihre Erfahrungen im Alltag zu präsentieren. Jede Massnahme wird strategisch über mehrere Medien umgesetzt: • 1. Videoreportage • 2. Redaktioneller Artikel • 3. Spezifische Posts in den sozialen Netzwerken • 4. Weitere Träger nach Massnahme • 5. Ausgewählte Projekte/ Massnahmen: Methan und Herdenmanagement; Staffelkulturen; CULTAN; Wärmerückgewinnung unter dem Dach; Beitrag für den Anbau von Körnerleguminosen | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/klimaplan-landwirtschaft | |
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft | 85% | 35% | Bevölkerung | 1 030 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft entwickelt konkrete Massnahmen für eine klimaresiliente Landwirtschaft, insbesondere im Bereich des Bodens. | Ziel des Bereichs ist es, konkrete Massnahmen für eine Anpassung der Betriebe an die veränderten Produktionsbedingungen zu entwickeln. Dazu gehören die Einführung resilienterer Produktionssysteme, eine Anpassung des Boden- und Wassermanagements oder der Fruchtfolge, Massnahmen im Rahmen der Agroforstwirtschaft oder die Reduzierung von Hitzestress. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: •Vertiefung des Themas Boden und klimaresiliente Landwirtschaft, inkl. Kohlenstoffsequestrierung in landwirtschaftlichen Böden, Verringerung der Erosion und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit; •Organisation eines Workshops mit den Sektorverantwortlichen von Grangeneuve, um die Beratung zu Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu stärken; •Entwicklung einer Massnahme, die ab 2024 die Gewährung eines Beitrags für den Anbau von Körnerleguminosen für die menschliche Ernährung ermöglicht. | Start der Massnahme zur Zahlung eines Flächenbeitrags von 400 CHF/ha für Körnerleguminosen, die für die menschliche Ernährung bestimmt sind, und Einführung von Aktivitäten zur Förderung ihres Absatzes. Insgesamt haben sich 28 Landwirtinnen und Landwirte mit einer Gesamtfläche von 70 ha angemeldet. Start der beiden Projekte Staffelkulturen (Ressourcenprojekt) und SIMONE. Nach der Einführung von AgroImpact: Koordination der Umsetzung des ClimaCert-Verfahrens, Recherche und Begleitung der landwirtschaftlichen Betriebe durch AGRI Freiburg. Über den Auftrag an AGRI Freiburg hinaus unterliegen auch die staatlichen Betriebe in Grangeneuve und Sorens dem ClimaCert-Verfahren. Vorbereitungsarbeiten für zwei neue Massnahmen: Wasserversorgung auf der Alp (Realisierung kleiner Bodenverbesserungsprojekte im Zusammenhang mit der Wasserversorgung der Alpen) und Unterstützung beim Erwerb von «Raindancer» (Steuerung der Bewässerung mit Kanonen mittels Geolokalisierung). | Hülsenfrüchte: Die für 2025 angemeldeten Flächen sind um 30 % geringer als die für 2024 angemeldeten Flächen, dem Jahr, in dem die Massnahme eingeführt wurde. Da IPS/Protaneo keinen Vertrag über die Erzeugung von Erbsen für 2025 unterzeichnet hat (ausreichende Lagerbestände), wird die Absatzlage weiterhin angespannt bleiben. Die Verträge für Ackerbohnen bleiben bestehen. AgroImpact/ClimaCert: Das Mandat von AGRI Freiburg wird verlängert. Die Pilotphase dauert noch bis Ende des ersten Halbjahres 2025. Der staatliche Betrieb St. Aubin wird dem ClimaCert-Verfahren unterzogen. Einführung von zwei neuen Massnahmen: Wasserversorgung auf der Alp und Unterstützung beim Erwerb von «Raindancer». Fortsetzung der Projekte Staffelkulturen und SIMONE. | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/plan-climat-agriculture/agriculture-resiliente | |
| Klimaplan Landwirtschaft | Bereich THG-Reduktion | 90% | 50% | Bevölkerung | 600 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Das Pooling bezeichnet die Bündelung von mehreren Massnahmen des landwirtschaftlichen Teils des kantonalen Klimaplans. Es ermöglicht, die Landwirtinnen und Landwirte bei der Bewältigung der Risiken des Klimawandels zu unterstützen und sie über ihre Handlungsmöglichkeiten zu informieren. Es ist in drei Bereiche unterteilt: Kommunikation, resiliente Landwirtschaft und Treibhausgasreduktion. Der Bereich THG-Reduktion entwickelt konkrete Massnahmen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. | In diesem Rahmen sollen Massnahmen entwickelt werden, die der Freiburger Landwirtschaft helfen, ihre Treibhausgasbilanz zu verbessern, indem sie ihre Produktionssysteme optimiert, fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt oder die Verschwendung von Nahrungsmitteln vermeidet. | Siehe spezifische Massnahmen | Siehe spezifische Massnahmen | Grangeneuve hat die folgenden Massnahmen und Projekte initiiert: • Projekt PROSCOR: untersucht die Futtermitteleffizienz von Fleisch- und Milchvieh; denn im Kontext des Klimawandels stehen Proteine tierischer Herkunft im Wettbewerb mit Proteinen pflanzlicher Herkunft, die als effizienter bei der Nutzung von Ressourcen gelten; • Methan und Herdenmanagement mit Anbringung von Methan-Sensoren (Sniffers) zur Messung der Methanemission; • Entwicklung einer App in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelbank und AGRI Freiburg zur Reduktion der Lebensmittelverschwendung; • Start der Arbeit zum Thema Energie auf den Alpen. | Offizieller Start der Projekte Methan und Herdenmanagement und PROSCOR und Anwerbung von Betrieben. Programmierung der Foodwaste-App. Abschluss der Arbeit zum Thema Energie auf den Alpen. Vorbereitende Arbeiten für die neue Massnahme «Stallklima» (Verbesserung des Stallklimas – Temperatur/relative Luftfeuchtigkeit – und damit Verminderung des Hitzestresses für die Tiere). | Fertigstellung der Foodwaste-App. Vor der Einführung wird noch eine Testphase mit Gemüsegärterinnen und ‑gärtnern durchgeführt und die Ausgestaltung der App weiter angepasst. Die Landwirtinnen und Landwirte haben über ihr Smartphone Zugriff und können ihre Angebote veröffentlichen. Die Freiburger Lebensmittelbank und AGRI Freiburg haben über eine Online-Plattform Zugriff, um die Angebote zu validieren (AGRI Freiburg) und den Bedarf bzw. die Anfragen zu veröffentlichen (Freiburger Lebensmittelbank). Einführung der neuen Massnahme «Stallklima». Fortsetzung der Projekte Methan und Herdenmanagement sowie PROSCOR. | • https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/fr/plan-climat-agriculture/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre • https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/proscor/ |
Transversal
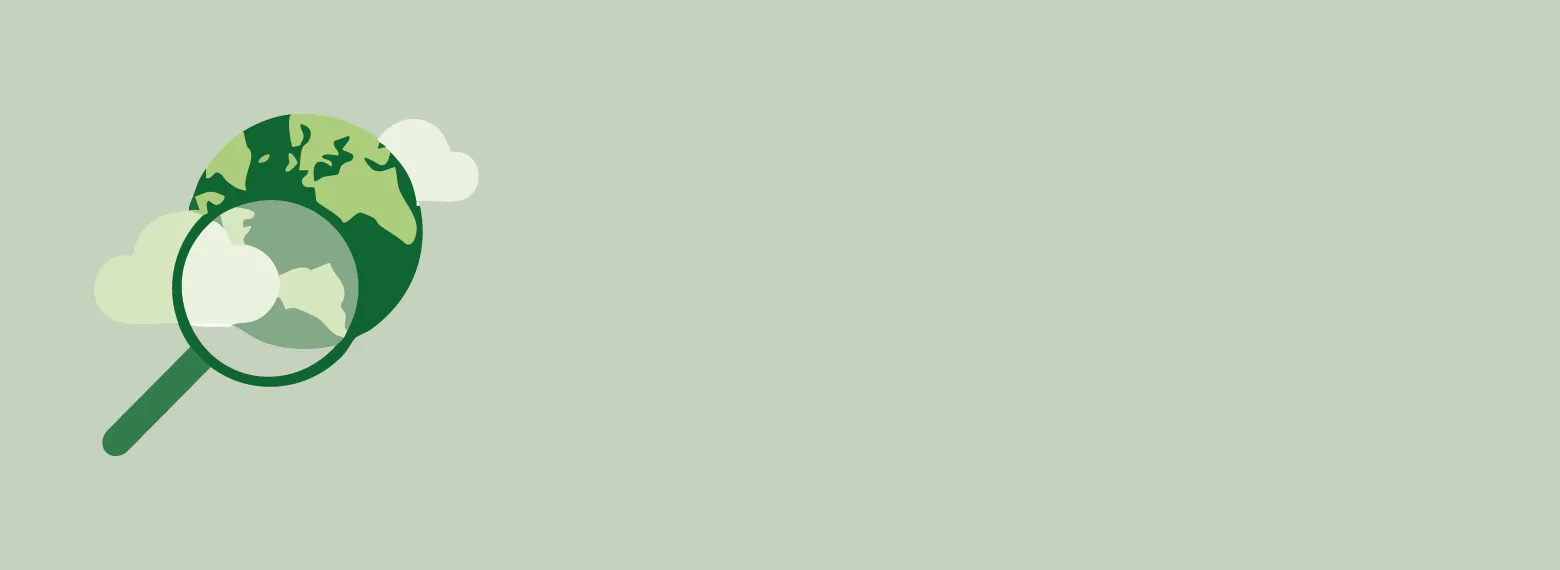
Die Achse Transversal fasst die Massnahmen zusammen, die alle anderen von den verschiedenen Achsen vorgeschlagenen Themen betreffen. Dazu gehören allgemeine und für den gesamten kantonalen Klimaplan strukturierende Massnahmen. Diese Achse beinhaltet auch Projekte, die einen Querschnittscharakter haben und in denen alle klimarelevanten Themen behandelt werden. Dies gilt für Massnahmen im Zusammenhang mit der Klimabildung oder bei Pilotprojekten in der Baubranche, die eine globale Herangehensweise an die verschiedenen Fragestellungen (menschliche Gesundheit, Biodiversität, Naturgefahren, usw.) vorsehen. Die Mehrzahl der in dieser Achse enthaltenen Massnahmen betreffen sowohl die Anpassung als auch die Verminderung.
Das Hauptziel der Achse Transversal besteht darin, das Funktionieren des kantonalen Klimaplans als Ganzes zu ermöglichen und Massnahmen vorzuschlagen, die alle mit dem Klimawandel verbundenen Themen miteinbeziehen.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ausblick 25+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.1.1 | Emissionsreduktionsziele für jeden Sektor | 70% | 60% | Staat FR | 160 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2025 | Paul Rwakabayiza | Ermittlung des Potenzials zur Senkung der Treibhausgasemissionen in den fünf Bereichen Industrie, Gebäude, Verkehr, Landwirtschaft und Abfall sowie Festlegung der Ziele. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme T.1.1 besteht darin, die Instrumente bereitzustellen, die nötig sind, um das kantonale Klimaschutzziel zu erreichen. | - | Das Jahr 2022 war auf zwei Hauptziele ausgerichtet: • Analyse der Massnahmen des kantonalen Klimaplans mit dem Ziel, die Konturen einer Methodik zur quantitativen und qualitativen Überwachung der Umsetzung des Klimaplans zu skizzieren; • Quantifizierung der Treibhausgasemissionen der Kantonsverwaltung und Ermittlung von Massnahmen zur Verringerung der Emissionen. | Im Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der Energiesicherheit sind Sachziele zur Reduktion der Treibhausgasemissionen (THG) vorgesehen. Mit dem Ziel, die kantonalen Absenkpfade der Treibhausgasemissionen im Kanton Freiburg für die Bereich Gebäude, Verkehr, Industrie, Landwirtschaft und Abfall zu identifizieren, wurde ein Auftrag vergeben. Die wichtigsten Ergebnisse werden den Direktionen im Winter 2023 vorgelegt. | Mit dem Ziel, die Klimastrategie des Kantons zu optimieren, wurden die Grundzüge einer Studie mit folgenden Zielen skizziert: • Identifikation sämtlicher Politikbereiche mit potenziell positiven Auswirkungen auf die Reduktion der Treibhausgasemissionen des Kantons • Zusammenstellung aller bibliografischen Daten zum finanziellen Aufwand, der zur Erreichung der CO₂-Neutralität erforderlich ist; • Vergleich der Investitionen des Kantons mit denen in der Literatur, Bewertung der Auswirkungen und Vorschlag von Massnahmen entsprechend den vorrangigen Emissionssektoren im Kanton. | Nach Abschluss der begonnenen Studie sollen ihre Schlussfolgerungen in die nächste Klimastrategie des Kantons einfliessen. Parallel dazu müssen ähnliche Überlegungen unter dem Gesichtspunkt der Anpassung an den Klimawandel angestellt werden. | - |
| T.1.2 | Langsamverkehr und Gesundheit | 35% | 15% | Gemeinden, Bevölkerung | 500 000 CHF | Amt für Gesundheit (GesA) | Im Gang | 2022-2026 | Marie Pichard | Ausbau der Fussgänger- und Velowege, die den Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen erlauben und Unterstützung der Programme Pedibus, Bike to School und Défi-Vélo, mit besonderem Schwerpunkt auf die neuen, von den Gemeinden getragenen Projekte. Sensibilisierungskampagne für sanfte und/oder nachhaltige Mobilität in Partnerschaft mit dem Amt für Gesundheit. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme T.1.2 besteht in der Unterstützung von Aktionen vor Ort, die sich an alle Altersgruppen richten und die sanfte Mobilität fördern. | - | Das Jahr 2022 diente dazu, den mit der Massnahme verbundenen Handlungsrahmen genau zu definieren. Es wurde beschlossen, das zur Verfügung stehende Budget zweizuteilen: • Der erste Teil dient der finanziellen Unterstützung der Aktionen des Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und insbesondere seiner Sektion Pedibus. Pedibus ist ein System, bei dem die Kinder unter Leitung eines Erwachsenen zu Fuss zur Schule gehen. • Der zweite Teil dient der teilweisen Finanzierung der Erstellung von Seniorenmobilitätsplänen in den Gemeinden des Kantons Freiburg in Zusammenarbeit mit dem VCS. | Die Pedibus-Koordination organisiert Veranstaltungen und stellt Projekte auf die Beine, um möglichst viel Aufmerksamkeit zu erhalten. Durch ein Märchenspektakel lernten über 300 Kinder das Pedibus-System kennen. Parallel dazu werden Eltern und Kinder dank der Zusammenarbeit mit Bibliotheken erreicht. Das Projekt «1,2,3... erforscht!» läuft bis Ende 2023 und wird 2024 die Möglichkeit bieten, das Projekt bei den ausserschulischen Betreuungsangeboten des Kantons zu bewerben. Das Projekt soll am 21. März 2024 bei der Generalversammlung des Verband der Ausserschulischen Betreuung des Kantons Freiburg vorgestellt werden. Neue Aktivitäten werden regelmässig online gestellt, damit die Nutzerinnen und Nutzer die Kinder weiterhin mitnehmen können, um die Biodiversität auf dem Weg zur Schule, zur Betreuung oder einfach bei einem Spaziergang mit der Familie zu erkunden. Mobilitätsplan für Senioren: Die Kommunikation mit allen Freiburger Gemeinden über die Einführung eines neuen Angebots wurde im Mai 2023 vom GesA in Zusammenarbeit mit den betroffenen Ämtern (MobA und SVA) und dem AfU lanciert. Im Anschluss an diese Mitteilung zeigten sich mehrere Gemeinden interessiert und baten um nähere Angaben zu den budgetären Möglichkeiten. Im Jahr 2024 wird es möglich sein, das Interesse dieser ersten Gemeinden zu überprüfen und gegebenenfalls eine Kommunikation über dieses für den Kanton Freiburg neue Angebot des VCS zu starten. | Die Massnahme T.1.2 ermöglichte auch in diesem Jahr die Unterstützung der Aktion Pedibus im Kanton, die das Bewusstsein für sanfte Mobilität und Biodiversität schärft. Entwickelt wurden: ein Experimentierset mit rund fünfzehn pädagogischen Arbeitsblättern, mit denen Kinder, ausgestattet mit Lupendosen und Pinseln, kleine Tiere in der Natur entdecken und lernen, ihre Umgebung zu beobachten und zu respektieren; ein Ausmal-Memory und ein 3D-Entdeckungsspiel (illustrierte Karte + reales Objekt), um eine konkrete und emotionale Verbindung zur Natur herzustellen. Darüber hinaus wurde die Präsenz von Pedibus vor Ort durch vier Stände (Bio-Märkte in Freiburg und Bulle, Dorffest in Marly, Juvénalia in Freiburg) und zwei Veranstaltungen in Bibliotheken (Granges-Paccot und Mémo in Freiburg – 20 Kinder), 1200 verteilten Flyern «1,2,3… erforscht!!» und mehr als 30 aufgehängten Plakaten im A1-Format verstärkt. Der Schlussbericht zu den Mobilitätsplänen für Senioren wurde an die erste angemeldete Gemeinde übergeben und soll in Kürze öffentlich vorgestellt werden. 2 weitere Gemeinden haben den Prozess mit dem Beauftragten eingeleitet, damit die Pläne bis Anfang 2026 umgesetzt werden können. Schliesslich wurde ein neues Mandat mit der HTA-FR (Prof. Marc-Antoine Fénart) begonnen, dessen Ziel es ist, die Fussgänger- und Veloinfrastrukturen zweier Gemeinden unter dem Gesichtspunkt des Labels Secure-pass zu bewerten, das im Rahmen einer Masterarbeit der HES-SO entwickelt wurde. | Neben der Fortsetzung der im Jahr 2024 gewährten Förderungen ist vorgesehen, einen Teil des Budgets 2025 für die Challenge Cyclomania (Pro Velo Schweiz) bereitzustellen, mit der Gemeinden zur Nutzung von Formen der sanfter Mobilität ermutigt werden. | • Projekt «1,2,3… erforscht!»: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/transversale/1-2-3-erforscht-ein-schluesselfertiges-projekt-fuer-kinder.html • Artikel «Mobilitätspläne für Senioren»: https://meinklimaplan.ch/freiburg/klimaplan/massnahmen/transversale/moebilitaetplaene-fuer-senioren.html |
| T.1.3 | Förderung des Wandels (Sensibilisierung und Engagement) | 245% | 70% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 265 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Ziel der Massnahme ist die Einführung von Instrumenten zur Begleitung des Wandels (Sensibilisierung und Engagement) innerhalb der gesamten Gesellschaft, d. h. innerhalb der Gemeinden, Unternehmen, Schulen, der kantonalen Verwaltung sowie der breiten Öffentlichkeit. Koordination der Schritte, die von diesen im Klimaschutz engagierten Akteuren unternommen werden. Entwicklung der Plattform meinklimaplan.ch und Kommunikation in den sozialen Netzwerken. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme T.1.3 besteht darin, Aktionen zur Sensibilisierung und zum Mitmachen vorzuschlagen, mit denen die gesamte Gesellschaft zur Annahme klimaschonender Verhaltensweisen ermutigt werden kann. | Die Massnahme T.1.3 führte zu folgenden Ergebnissen: • Erarbeitung einer Kommunikationsstrategie mit Unterstützung des Büros NewElement; • Ausarbeitung des Flyers «Auf dem Weg zu Netto-Null», der ursprünglich für die Mitglieder des Kantonsparlaments bestimmt war, und die wichtigsten Achsen des kantonalen Klimaplans zusammenfasst; • Durchführung von 3 Klima-Lunches: -Klima-Lunch Nr. 6 «Der Hitzeinseleffekt», am 20. Mai; -Klima-Lunch Nr. 7 «Klima und Schulen: welche Perspektiven?», am 15. Juni; -Klima-Lunch Nr. 8 «Die Gebäudeplanung im Zeichen des Klimawandels», am 21. Oktober. • Organisation in Zusammenarbeit mit dem Büro Eqlosion des Climathon Fribourg, am 24. und 25. September 2021 – ein kostenloser, 24-stündiger, non-stop Ideen-Marathon zum Klima (100 % online); • Einrichtung des Instagram-Accounts @monplanclimat_meinklimaplan; • Erstellung eines neuen Reiters auf der Plattform meinklimaplan.fr.ch, um den Gemeinden die notwendigen Instrumente für die Umsetzung der Klimastrategie zur Verfügung zu stellen; • Durchführung eines ersten Interviews mit der Gemeinde Villars-sur-Glâne, das im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 ausgestrahlt wird. | Die Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Anpassung der Plattform, damit sie den Richtlinien für barrierefreie Webinhalte entspricht (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG), Konformitätsstufe AA; • Veröffentlichung eines Quiz in Zusammenarbeit mit den TPF zum Themenbereich Elektromobilität; • Einführung einer Grafikcharta; • Organisation von Veranstaltungen, darunter ein Klima-Lunch zu CO₂-Bilanzen am 10. März und ein zweiter Klima Lunch zu landwirtschaftlichen Böden am 13. Oktober, ein Treffen der Massnahmenverantwortlichen (Experten-Workshop) und ein Workshop mit den Gemeinden; • Aufschalten einer Internetseite, die den Massnahmen des KKP gewidmet ist und auf der sechs «repräsentative» Massnahmen veranschaulicht werden; • Lancierung der interkantonalen Plattform meinklimaplan.ch am 28. November; • Umstrukturierung der Plattform für eine Navigation nach Zielgruppen; • Durchführung eines Wettbewerbs zur Bewerbung der interkantonalen Plattform; • Erhöhung der Sichtbarkeit der Plattform durch die regelmässige Veröffentlichung von Inhalten. | Die Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: •Umsetzung der Kommunikationsstrategie 2023 durch ein Kontrollmandat; • verstärkte technische Unterstützung der Gemeinden; • Produktion von Inhalten für die breite Öffentlichkeit; •regelmässige Erstellung von Inhalten für soziale Netzwerke. | Die Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: •Umsetzung der Kommunikationsstrategie durch ein an Wapico vergebenes Beobachtungsmandat; • technische Unterstützung für interkantonale Kommunikationsmassnahmen; •Produktion von Inhalten für die breite Öffentlichkeit; • Logistikkosten im Zusammenhang mit den Klima-Lunches und den verschiedenen Workshops für Gemeinden oder Verantwortliche für die Umsetzung der Massnahmen des kantonalen Klimaplans. | Fortsetzung der Finanzierung der 2024 durchgeführten Aktivitäten. | • Plattform: https://monplanclimat.fr.ch/ • Medienmitteilung zur Lancierung der Plattform: https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/klima/news/eine-interkantonale-plattform-fuer-das-klima |
| T.2.1 | Unterstützung der Klimamassnahmen im Schulnetz21 | 0% | 0% | Noch nicht definiert | 70 000 CHF | Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht (FOA) | Noch nicht begonnen | 2025-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Förderung des Netzwerks gesundheitsfördernder und nachhaltiger Schulen und Unterstützung der Klimamassnahmen. | - | - | - | - | - | - | |
| T.4.1 | An die Klimaziele angepasste kantonale Rechtsgrundlagen | 0% | 45% | Staat FR, Gemeinden, Vereinigungen, Bevölkerung | 85 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Térésa Lefebvre | Inkrafttreten und Umsetzung des kantonalen Klimagesetzes, wie es infolge der Motion 2019-GC-44 Senti-Mutter angenommen wurde. Ziel dieses Gesetzes ist die Verankerung der Klimastrategie in einer gesetzlichen Grundlage, die Festlegung des Klimaziels sowie die Umsetzung des Finanzierungsmechanismus für die mit der Strategie verbundenen Massnahmen. Darüber hinaus wird eine Analyse der kantonalen Vorschriften unter dem Gesichtspunkt der Klimaziele nach Artikel 12 des Klima- und Innovationsgesetzes des Bundes durchgeführt. | Die Massnahme hat die Verabschiedung und Umsetzung des kantonalen Klimagesetzes sowie seines Ausführungsreglements zum übergeordneten Ziel. | Der Staatsrat hat im September den Vorentwurf des kantonalen Klimagesetzes (KlimG) verabschiedet, der im Anschluss Gegenstand einer dreimonatigen öffentlichen Vernehmlassung bis Dezember desselben Jahres war. | Das Jahr begann mit der Erstellung des Berichts über die öffentliche Vernehmlassung des Gesetzesvorentwurfs; im Anschluss daran wurden der Gesetzesentwurf sowie die begleitende Botschaft angepasst. Der Gesetzesentwurf wurde vom Staatsrat am 20. Dezember 2022 angenommen. Im November nahm die zu diesem Anlass ernannte ordentliche Kommission die Arbeit auf. | Das Klimagesetz ist am 1. Oktober 2023 in Kraft getreten. Am 30. Juni 2023 verabschiedete der Grosse Rat mit grosser Mehrheit das kantonale Klimagesetz (KlimG) sowie die Änderung einiger Artikel des Naturschutzgesetzes (NatG), die in den Entwurf des KlimG integriert worden waren. Nachdem innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen kein Referendumsbegehren angekündigt wurde, hat der Staatsrat das Gesetz promulgiert und dessen Inkrafttreten auf den 1. Oktober festgesetzt. Die Arbeiten zur Erstellung des Ausführungsreglements sind im Gang. | Der Entwurf des Ausführungsreglements zum KlimG (KlimR) wurde im Frühjahr 2024 in die interne und im Februar 2025 in die öffentliche Vernehmlassung gegeben. | Die Verabschiedung des KlimR ist für Ende 2025 vorgesehen. Für die Umsetzung der Pflicht, bei wichtigen staatlichen Projekten eine Klimaverträglichkeitsprüfungen durchzuführen (Art. 5 Abs. 2 KlimG), müssen technische Unterlagen, Leitfäden und Schulungen erarbeitet werden. | • Medienmitteilung zum Inkrafttreten des kantonalen Klimagesetzes: https://www.fr.ch/de/energie-landwirtschaft-und-umwelt/klima/news/das-kantonale-klimagesetz-tritt-am-1-oktober-2023-in-kraft • SGF 815.1 – Klimagesetz (KlimG) https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/815.1 • https://www.fr.ch/de/rimu/afu/news/der-entwurf-zum-klimareglement-geht-in-die-vernehmlassung |
| T.5.1 | Bekräftigung des Themas Klima im Bildungswesen | 100% | 40% | Bevölkerung | 350 000 CHF | Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht (FOA) | Im Gang | 2022-2026 | Gijs Plomp | Erstellung eines pädagogischen Dossiers (Referenzen, Workshops, Referentenliste), mit dem Ziel, die Integration von Klimafragen in der Bildung auf allen Stufen zu stärken und zu unterstützen. | Die Massnahme T.5.1 bezweckt hauptsächlich die Erstellung von Lehrmitteln rund um das Thema Klima. Die Massnahme zielt auch darauf ab, die Lehrkräfte in der Nutzung der Lehrmittelpakete zum Klima zu schulen und sie zu ermutigen, diese Mittel in ihren Klassen zu nutzen. Die Durchführung einer Klimawoche vom 13. bis 17. Mai 2024 ist Teil dieses Konzepts. | - | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Etwa 20 Lehrpersonen nahmen am Klimafresko teil und wurden darin geschult, das Fresko in ihren Klassen einzusetzen. • Zwei Arbeitsgruppen erfassten bestehende pädagogische Ressourcen und entwickelten Ideen für ein pädagogisches Dossier rund um das Thema Klimawandel. Die Vorschläge der beiden Gruppen wurden in ein einziges Konzept, die Klimawoche, integriert. Dieses Konzept wird in den Klassen des 1., 2. und 3. Zyklus in einem «à la carte»-Format eingesetzt und dreht sich um die mit dem Klimawandel verbundenen Fragen und Herausforderungen, die die Klassen während der Klimawoche behandeln sollen. | Planung und Vorbereitung der Organisation der Klimawoche, insbesondere mit: • mehr als 50 schlüsselfertige Aktivitäten für Klassen und Schulen aller Stufen der obligatorischen Schulzeit; • Basismaterial für die Durchführung der wichtigsten Aktivitäten wie etwa die Karten des Workshops «Klimafresko» oder das Buch «Tout comprendre (ou presque) sur le climat»; • einem Video mit Julien Sprunger als Ermutigung; • einer Website, auf der alle Herausforderungen, die die rund 500 teilnehmenden Klassen ausgewählt haben, veröffentlicht werden; • einer Partnerschaft mit den TPF, damit jede Klasse von der kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel profitieren kann, um im Mai 2024 einen inspirierenden Ausflug im Zusammenhang mit der Klimawoche zu unternehmen. | Die erste Klimawoche fand vom 12. bis 17. Mai 2024 statt. Es wurden mehr als 50 schlüsselfertigen Aktivitäten für Klassen und Schulen aller Zyklen der obligatorischen Schule vorgeschlagen. Zudem wurde Basismaterial für die Durchführung der wichtigsten Aktivitäten verteilt, beispielsweise die Karten des Workshops «Klimafresko» oder das Buch «Tout comprendre (ou presque) sur le climat». Es wurde ein Video mit Julien Sprunger als Ermutigung gedreht und veröffentlicht. Auf einer Website werden alle Herausforderungen veröffentlicht, die von den rund 500 teilnehmenden Schulklassen ausgewählt wurden. Eine Partnerschaft mit den TPF erlaubte allen Schulklassen die kostenlose Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, um im Mai einen inspirierenden Ausflug im Zusammenhang mit der Klimawoche zu unternehmen. Das im Rahmen einer Umfrage erhaltene Feedback fliesst in die Planung der Klimawoche 2025 ein. Die Klimawoche wird für 2025 und 2026 verstetigt. | Organisation der Klimawoche 2025 vom 19. bis 23. Mai mit der Biodiversität im Mittelpunkt der Veranstaltung. Für Schulen werden Aktivitäten und Workshops angeboten. Das Programm konkretisieren: Anpflanzungen, Ersatz von Bäumen und Entdeckung lokaler Arten. In Zusammenarbeit mit dem Biologen Jérôme Géraud werden auf den Schweizer Kontext zugeschnittene Fresken zum Thema Biodiversität entwickelt. | • Website zur Klimawoche: https://semaineduclimat.ch/ • Klimawoche 2024 – Die Ermutigungen von Julien Sprunger: https://youtu.be/xgP1fEU9P3Q |
| T.6.1 | Durchführung eines Pilotprojekts für ein den klimatischen Herausforderungen angepasstes Gebäude | 35% | 20% | Staat FR, Vereinigungen | 450 000 CHF | Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU) | Im Gang | 2021-2026 | Marie Pichard | Durchführung eines vorbildlichen Projekts für die Sanierung eines bestehenden Staatsgebäudes oder für den Bau eines neuen Gebäudes. Dieses Gebäude ist sowohl energetisch als auch in Bezug auf die Anpassung an den Klimawandel vorbildlich. Dazu gehören nicht zuletzt der Komfort der Nutzer bei grosser Hitze (Gesundheit), ein begrenzter Wasserverbrauch und die Vorbeugung des Oberflächenabflussrisikos durch eine geeignete landschaftliche Gestaltung der Aussenräume. Das Gebäude könnte auch SNBS-zertifiziert werden. Es dient als Vorbild und Inspiration für andere Projekte. | Die Massnahme T.6.1 verfolgt das übergeordnete Ziel, die Umsetzung (Erneuerung oder Neubau) eines Gebäudes, das sowohl in Bezug auf seine Energieeffizienz als auch hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel beispielhaft ist, zu unterstützen. Dieses Gebäude soll gleichzeitig einen niedrigen CO₂-Ausstoss aufweisen, den Nutzerinnen und Nutzern bei grosser Hitze Komfort bieten und nur wenig Wasser verbrauchen. Ausserdem soll es dazu beitragen, das Risiko des Oberflächenabflusses zu verringern und die Biodiversität zu fördern. | Durch die Massnahme T.6.1 wurden folgende Ergebnisse erzielt: • Auswahl des zu fördernden Projekts; • Vorbereitung des SIA-Wettbewerbs unter Berücksichtigung der Kriterien dieser Massnahme. | Fortführung der Vorbereitung eines SIA-Wettbewerbs (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein). Insbesondere Einbeziehung relevanter Berufsgruppen in die Jury (z. B. Begrünung der Oberflächen, Wiederverwendung von Baumaterialien). | Dank der Massnahme konnte die Anwesenheit eines Experten, Herrn Sergi Aguacil, in der Arbeitsgruppe finanziert werden, die sich mit der Vision für die Entwicklung der Pérolles-Ebene befasst, der sein Wissen über die Integration von Klimakriterien in Architekturprojekte, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Hitzeinseln, einbringen konnte. | Die Massnahme ermöglichte es, das Radonrisiko im künftigen Gebäude des Smart Living Lab zu berücksichtigen, indem Sonden hergestellt wurden, mit denen die Radonkonzentrationen im Laufe der Zeit überwacht werden können, und so die künftigen Nutzerinnen und Nutzer zu schützen. | Es geht darum, das oder die Projekte zu identifizieren, die dem Ziel der Massnahme T.6.1 entsprechen. | • Programm des SIA-Wettbewerbs für die Fassadensanierung (nur auf Französisch): https://espazium.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/2022-11/Document%20A_Programmeduconcours_04.11.2022.pdf • https://latele.ch/emissions/info-fribourg/info-fribourg-s-2025-e-62? • https://www.laliberte.ch/articles/regions/canton/un-nouveau-laboratoire-avant-gardiste-a-fribourg-tentera-den-savoir-plus-1016607 |
| T.6.2 | Unterstützung von Wettbewerben und Veranstaltungen für die Jugend | 185% | 40% | Staat FR, Bevölkerung | 100 000 CHF | Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht (FOA) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung bei der Umsetzung eines Projekts, das von einer Klasse im Rahmen des Wettbewerbs «Le climat et moi» entwickelt wurde, Unterstützung der «6h de Fribourg» und von anderen kommenden Wettbewerben und Veranstaltungen. | Die Massnahme T.6.2 hat das übergeordnete Ziel, die Freiburger Schulklassen finanziell zu unterstützen, die sich am Wettbewerb «Le climat et MOI» beteiligen. Dieser wird von Environnement et jeunesse organisiert. Die dank dieser Massnahme gewährleistete finanzielle Unterstützung ermöglicht es Schülerinnen und Schülern sowie Klassen: • ein umfassenderes Projekt zu schaffen; • sich neue wissenschaftliche und technische Kenntnisse anzueignen (über ein professionelles Mandat); • die Sichtbarkeit ihrer Arbeiten zu verbessern und die Beteiligung zu steigern (Kurzvideo). | Die Massnahme T.6.2 führte zu folgenden Ergebnissen: -finanzielle Unterstützung der Freiburger Klassen, die am Wettbewerb teilgenommen haben (drei Bereiche): -Durchführung des Projekts (Material, Infrastruktur usw.); -technische oder wissenschaftliche Unterstützung mittels Beauftragung einer professionellen Mandantin oder eines professionellen Mandanten (Coaching, Beratung usw.); -finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts innerhalb eines grösseren Rahmens; • Finanzielle Unterstützung für die Realisierung von vier Projekten von Freiburger Schulklassen, die am Wettbewerb teilnehmen; • Herstellung eines Kurzvideos vor Ort, das verschiedene Projekte präsentiert, die im Rahmen des Wettbewerbs durchgeführt wurden. | Für das Jahr 2022 ermöglichte diese Massnahme die Unterstützung der Veranstaltung 6h de Fribourg (6 Stunden von Freiburg), eine Schweizer Veranstaltung, die das Erlernen neuer Energien durch ein Symposium (Vortragsreihe) und eine Schweizer Auto-Challenge mit 1/10-Autos mit Brennstoffzellenantrieb (Wasserstoff) fördert. | Für das Jahr 2023 ermöglichte diese Massnahme die Unterstützung eines Workshops für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der Ausstellung «Erde am Limit» im Naturhistorischen Museum in Freiburg. Dieser Workshop hatte die Umweltauswirkungen von Smartphones zum Thema und sollte die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, einen kritischen und autonomen Blick zu entwickeln, sich auf der Grundlage ihres Wissens und ihrer Werte zu positionieren und die Auswirkungen ihrer persönlichen Entscheidungen auf das gesamte Umweltsystem zu analysieren. Insgesamt nahmen 1530 Schülerinnen und Schüler aus 93 Klassen der Klassen S1 und S2 (Berufsbildung, Kollegium, Fachmittelschule, Integration und Motivationssemester) an diesem Workshop teil. Darüber hinaus wurde die Unterstützung des Wettbewerbs «6h de Fribourg» fortgesetzt und über die Massnahme M.2.3 finanziert. | Die Massnahme ermöglichte die Unterstützung der Wanderausstellung «Reiseziel Erde» für Klassen der Sekundarstufe II (S2) in Freiburg. Diese interaktive Ausstellung hatte zum Ziel, auf den kritischen Zustand unseres Planeten aufmerksam zu machen und zum Handeln für den Erhalt der Erde aufzurufen, indem sie Themen wie Biodiversität, Klimawandel und kollektive Verantwortung auf leicht verständliche Weise präsentierte. Die Massnahme ermöglichte auch die Unterstützung der Ausstellung «Erde am Limit» im Naturhistorischen Museum Freiburg, insbesondere durch Workshops, die die Schülerinnen und Schüler während ihres Besuchs begleiteten. | Es wird darum gehen: die Klimabildung in den Klassen der S2 zu unterstützen; die 6 Stunden von Freiburg (Grand Prix von Wasserstoffautomodellen im Massstab 1:10) zu unterstützen; die Klassen zu fördern, die an der 20. Ausgabe des Wettbewerbs «Environnement et jeunesse – MISSION TRANSITION» teilnehmen. | • Kurzvideos mit den verschiedenen Projekten des Wettbewerbs «Le climat et MOI» : https://www.youtube.com/watch?v=E6AP8ODJa14 • Website der HIKF – 6 Stunden von Freiburg: https://www.ccif.ch/communication/news-et-communiques/2022/6h-de-fribourg.html • Mediendossier «Erde am Limit»: https://www.fr.ch/de/document/510921 • Pädagogische Unterlagen rund um die Umweltauswirkungen von Smartphones: https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-08/nhmf--padagogische-unterlagen-hallo.pdf |
| T.6.3 | Die Wirksamkeit und die Umsetzung des kantonalen Klimaplans sicherstellen | 160% | 70% | Staat FR | 900 000 CHF | Amt für Umwelt (AfU) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Koordination (Teilnahme an den Arbeitsgruppen, Unterstützung der Teamchefs/-innen, Monitoring des Fortschritts der Arbeiten, Monitoring der Ergebnisse der Massnahmen, usw.) der Umsetzung der 115 Massnahmen des Klimaplans. Verwaltung und Koordination des Budgets der 115 Massnahmen. | Die Massnahme T.6.3 hat das übergeordnete Ziel, die Koordination, Erfolgskontrolle und Verwaltung der Umsetzung der 115 Massnahmen des KKP zu gewährleisten. Um dies zu erreichen, werden die notwendigen Ressourcen und Kompetenzen unter anderem von der Sektion Klima zur Verfügung gestellt. Zu den Aufgaben dieser Massnahme zählt auch, ganz im Sinne des KKP, die Koordination auf verschiedenen Ebenen (Bund, Kantone, Gemeinden). | Durch die Massnahme T.6.3 wurden folgende Ergebnisse erzielt: • Einstellung von zwei Mitarbeitenden in der Sektion Klima über befristete Verträge (insgesamt 1,6 VZÄ); • Einstellung eines Mitarbeiters über einen externen Auftrag (0,8 VZÄ); • Koordination innerhalb des Staats, insbesondere Organisation der COPIL; ; • Unterstützung und Beratung der Massnahmenverantwortlichen; • Teilnahme an den vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) geleiteten Koordinationssitzungen zwischen den Schweizer Kantonen; • Teilnahme an den Koordinationssitzungen der Westschweizer Kantone; • Beginn der Arbeiten für die Entwicklung eines Management-Tools zur Koordination und Überwachung der Massnahmen. | Die im Jahr 2021 erbrachten Leistungen konnten im Jahr 2022 beibehalten werden. Der erste Workshop mit den Expertinnen und Experten wurde per Videokonferenz abgehalten; ca. 50 Personen nahmen daran teil. Ziel des Workshops war, den Austausch zwischen den bereits an der Umsetzung im Jahr 2021 beteiligten Personen und den neuen Massnahmenverantwortlichen zu verbessern und gleichzeitig die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen zu teilen und die Koordinierungsprozesse zu verbessern. Die Hauptanliegen, die sich herauskristallisierten, betrafen die personellen und finanziellen Ressourcen in den verschiedenen Ämtern sowie die Verbesserung der Governance. Des Weiteren konnten die Arbeiten für die Entwicklung eines Management-Tools zur Koordination und Überwachung der Massnahmen begonnen werden. | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: • die Schaffung eines Tools zur Erstellung der CO₂-Bilanz für die Gemeinden im Zusammenhang mit dem kantonalen Klimagesetz, das am 1. Oktober 2023 in Kraft trat, und der Rolle der Gemeinden (Art. 17); • die Aufrechterhaltung der Einstellung von Personal für die Koordination der Umsetzung des KKP; • die Weiterführung der Arbeiten zur Schaffung des Verwaltungstools «Cockpit», insbesondere durch den regelmässigen Austausch mit dem ITA. | Die Umsetzung dieser Massnahme hat Folgendes ermöglicht: • die Neuberechnung der kantonalen CO₂-Bilanz nach Artikel 11 des kantonalen Klimagesetzes (KlimG); • die Beibehaltung des Personals für die Koordination der Umsetzung des KKP; • die Einführung eines partizipativen Ansatzes für die Erneuerung des KKP. | Im Jahr 2025 soll der partizipative Ansatz für die Erneuerung des KKP fortgesetzt und abgeschlossen werden, ebenso wie die Neuberechnung der CO₂-Bilanz und die Weiterbeschäftigung des Personals für die Koordination der Umsetzung des KKP. | - |
